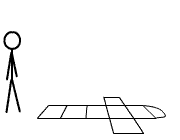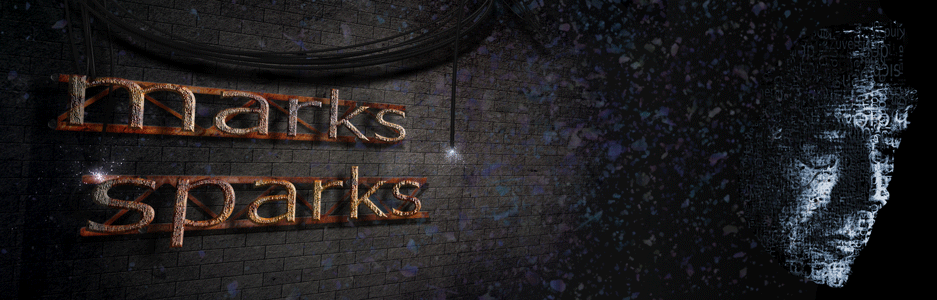Am Vorabend meines siebten Geburtstags wünschte ich mir vor dem Einschlafen nichts sehnlicher, als Schnee für meinen Tag. Als am nächsten Morgen die ersten gedämpften Straßengeräusche an meine Ohren drangen, wusste ich im gleichen Moment und auch ohne aus dem Fenster zu sehen, dass mein Wunsch auf wunderbare Weise erfüllt war.
Irgendwann – und ein paar Einsichten später – beschloss ich, auch Venedig nur noch im Winter zu besuchen. Nicht, dass ich darauf hoffte, die Lagunenstadt einmal unter einem kalten Leintuch zu erleben. Schnee ist mir nicht mehr wichtig, aber Wunschlosigkeit bewahrt weitgehend vor Enttäuschungen. Ich fahre also einfach hin und lasse auf mich zukommen. Habe lediglich eingepreist, dass es eher wenig Sinn macht, der Poesie der Kanäle, Plätze und Gässchen in einem endlosen Menschenschwarm nachspüren zu wollen. Zu Ferienzeiten verkommt der Zauber vollends zum Rummel.
Mein Venedig ist so. Noch bevor ich die Augen aufschlage, weiß ich, dass es regnet. Ahne, wie es sich sanft und auf beschlagene Scheiben setzt und perlend seinen Weg sucht. Lausche dem Zerplatzen unzähliger Tropfen auf meinem Fensterbrett. Der vielstimmigen Wassermusik zinkener und kupferner Traufen. Nicht einmal habe ich mich in dieser Stadt über einen verregneten Tag geärgert. Warum auch? Lässt direktes Licht nicht jede Diva alt aussehen?
Der Vormittag ließe sich prächtig hinter der Glasfront eines Cafés vertrödeln. Wider alle Vernunft wäre vielleicht doch eine Gesetzmäßigkeit hinter der Abfolge der Böen erkennbar, die in Abständen die Lagune aufpeitschen und Schaumfetzen gegen das Fensterglas gischten. Vergiss es. Nicht alles unterwirft sich dem menschlichen Begehr nach Einordnung. Wie wäre es, Vaporetti und Lastkähnen einmal erwartungslos hinterherzuträumen, um Abstand zum Selbstanspruch zu gewinnen? Einen anerkennenden Pfiff für die Eleganz einer hochglanzgewienerten Serenella übrig zu haben? Im hypnotischen Ab und Auf lose vertäuter Gondeln alle Kontrolle abzustreifen und ermüdende Lebenswut gegen Bedürfnislosigkeit einzutauschen?
Schon am frühen Nachmittag treibt es mich wieder hinaus in die Gässchen von Castello oder Cannaregio. Bewehrt mit Schirm und Kamera. Vielleicht unterbreche ich eine Überfahrt nach Murano auf der Friedhofsinsel San Michele. Hinter rostrotem Backstein erwartet den Besucher eine stille Welt, in der nach Jahreszeit und Witterung das Konzert der Zikaden, Vogelgezwitscher, oder der Wind in den Zypressen die Hintergrundmusik machen. Ich weiß es, weil ich seit Jahrzehnten zurückkomme. An Tagen wie diesen trommelt es freilich nur nachdrücklich auf den Regenschirm.
Obgleich omnipräsent, stolpert man auf diesem Friedhof eher zufällig über Grabsteine mit weltbekannten Namen. Welche gedankenlos oder unwissend zwischen liebevoll gepflegtes Familiengedenken und verwitterte Namenlosigkeit verstreut zu sein scheinen. Weit gefehlt. Auf San Michele bleiben die einst Gefeierten und Privilegierten absichtsvoll nicht unter ihresgleichen. Lage ihrer Ruhestätte bestimmen ausschließlich Todeszeitpunkt und Konfession. Indessen lassen auch aufwändige Gestaltung, Dimension und Pflegezustand steingewordener Pietät keineswegs zwingend auf einstige monetäre Potenz oder Prominenz ihrer Einlieger rückschließen. Häufiger mag der hilflose Versuch hinter jenem Übermaß stecken, die Unbegreiflichkeit eines finalen Verlusts irgendwie zu verarbeiten. Ein Jammer, dass sich Verzweiflung nicht mal unter solidem Marmor begraben lässt.
Wie verstörend vertraut Glück und Leid immer wieder beieinander liegen. Noch vorgestern als Odette oder Odile schwerelos über die Bühne geschwebt, wird man deinen biegsamen Leib vielleicht schon übermorgen entseelt, leichenstarr und rührend rausgeputzt inmitten Fassungslosigkeit, hilflosem Pathos und weißer Calla ausstellen. Ein stolzer Schwan, der in dieser Welt nie wieder schweben wird. Am Abend setze ich in „meinem Quartiere“ ein paar Reflexionen in Szene. Nach Motiven musst du in Venedig kaum suchen.



An einem klaren Tag zieht es mich womöglich weiter in die Lagune hinaus. Torcello, Mazzorbo oder Burano sind eine gute halbe Bootsstunde von der Fondamente Nove entfernt. An wolkenlosen Wintertagen leuchten die Farben der Fischerhäuser immer besonders. Am Rand eines geschäftigen Platzes finde ich eine Bank und suche so zu gucken, als gehöre ich selbstverständlich zum ansässigen Alltag.
Die Insulaner übergehen meine einfältige Mimikry vermutlich gedankenlos. Die paar Chinesen sind mit Schnütchenschieben und Selfies am Stiel ausgelastet. Offensichtlich ist an diesem Tag jeder bei- und mit sich. Freiräume bleiben grenzenlos. Also wende ich mich endlich dem zu, was geschäftige Marktleute auf Empfehlung und Ansage eingepackt haben. Der halben Dauerwurst und einem milden Asagio. Dem großzügig bemessenen Stück Guanciale – warum nicht? Oliven und gefüllte Weinblätter gehen auch immer. Eine krossgebackene Ciabatta sowieso. Wasser – kein Wein. Alkohol macht mich nur noch rührseliger oder mal richtig wirr.
Augenblicke wunschlosen Erlebens, entkoppelt von Rückblenden und Antizipation. Der perfekte Moment die eigene Rastlosigkeit einmal einzustellen – eigentlich. Gleichwohl so unwirklich, gerade jetzt an diesem gesegneten Fleckchen ausruhen zu dürfen – und sich nicht sehnsuchtsvoll hierher träumen zu müssen.