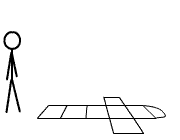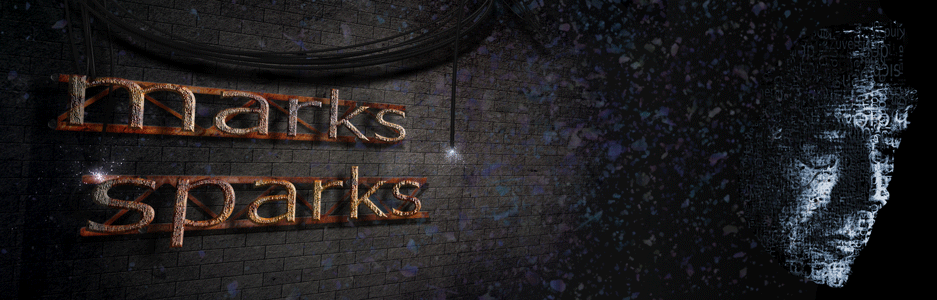Wie kann es angehen, dass die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ihrer Lieblingszielgruppe trotz Zwangsabgabe allvorabendlich unappetitliche Unterleibsthemen am Stück aufdrängen dürfen? In jeder Werbepause die nämliche Leier. Nervensägende Empfehlungen zur Vertuschung von Inkontinenz, der medikamentösen Abhilfe einer soliden Verstopfung oder ein Pülverchen gegen infernalische Flatulenzen.
Anhand der bereitgestellten Statistik zu Beginn eines der unsäglichsten Spots soll dem Blasenschwächling vor der Mattscheibe vermutlich aufmunternd signalisiert werden, dass er mitnichten allein mit seinem urinösen Thema ist. Sondern offenbar jeder vierte deutsche Schwanzträger ab dem vierzigsten Lebensjahr gewahr sein muss, dass sein ganzer Stolz jederzeit unpassend und schmählich in Feinripps und Bollerbux entwässern könnte. Und wer möchte schon die tragische Figur abgeben, die für Statisten wie zufälliges Publikum kaum etwas als Mitleid, Fremdscham oder ein wieherndes Schenkelklopfen übrig lässt?
Dieser schludrig synchronisierte Aquarianer, aufgrund seiner inkohärenten Mundbewegungen unschwer als Faketeutone zu identifizieren, ist nach eigenem Bekunden von einer solchen Blasenschwäche befallen. Der gute Mann hat freilich vorgesorgt. Hinter der Frontbeule seiner Boxershorts schmiegen sich nämlich nicht nur Schniedel und Skrotum in schwitziger Zweisamkeit. Vielmehr stemmt sich daselbst eine zugefügte, Männerwindel gegen seine allfällige Leckage, wie der poröse Pieselpumpel verwirrend freimütig vorträgt. Der Dentalfriedhof könnte weiteres Indiz für einen allzu losen Umgang mit Reputation und Gesundheit sein.
Noch habe ich freilich leicht beckmessern. Weder von unerwünschter Undichtigkeit geplagt, noch mit einer launischen Warenausgabe oder einem gammeligen Gebeiß geschlagen – und angesichts solcher Perspektiven absolut gewillt, dergleichen in diesem Leben unbeugsam entgegenzuwirken. Obwohl Gesundheit unstreitig genetischen Dispositionen oder Umweltbedingungen unterworfen ist, so ist sie deswegen noch lange kein Selbstläufer. Knatschige Frühstückssemmeln aus der Schnabeltasse lutschen, ein klammes Vlies am Gemächt – so weit solltest du es selbst mit einer kippeligen Selbstachtung bitte nie kommen lassen. Vor allem solltest du mit sowas nicht bei einem Millionenpublikum hausieren gehen.
Die signifikante Zunahme Alter-Leute-Malaisen in mittleren Jahren ist auch Konsequenz einer Bequemlichkeit, die es offensichtlich vorzieht, sich Abführmittel einzupfeifen oder zu windeln, als beizeiten fürsorglich mit dem eigenen Körper umzugehen. Willenloses Suchtverhalten, Trägheit und ein zuviel an Fertigfutter machen auf Dauer nun mal chronisch krank. Insbesondere die Abkehr vom handwerklichen Kochen mit frischen Zutaten erweist sich zunehmend als folgenreich.
Auch Speisenzubereitung muss im Zeitalter des Konsumismus hurtig und simpel abgetan sein. Wird doch die freud- und lieblos zusammengepanschte und geschmacksgepimpte Fabrikpampe sowieso meist achtlos reingeschippt. Nahrungszufuhr ist längst zur Nebensache verkommen. Zum angeregten Bröckchenaustausch – bei Banalität und Grundsatzdiskussion – zwischen Freund und Fremd. Zu einem halbherzigen Snack auf Heimweg und Faust – bevor der kleine Hunger zuschlägt. Süßsauer oder gepfeffert und versalzen auf der heimischen Sitzlandschaft – jedenfalls in verlässlicher Greifweite von Smartphone und Spielekonsole.
Wer heute nicht pausenlos drei Tätigkeiten gleichzeitig gestemmt kriegt, gilt bei hartleibigen Multitaskern ohnehin als hoffnungslos hängengeblieben. Hingegen dezenter Gaumenkitzel und unverdünnte Sinnenfreude zunehmend zu entbehrlichen Atavismen verkommen. Das chronisch irritierte Zentralnervensystem muss die fortgesetzten Zumutungen irgendwann beinahe zwangsläufig mit Meuterei quittieren. So verfettet der Gleichzeitler nicht nur häufig an solch zivilisatorischen Auswüchsen, er verblödet auf der ständigen Hatz nach immer mehr Effizienz auch erschreckend.
Dem einmal angefütterten Xenophobiker mag das längst integrierte Angebot hin und wieder gar zur Gretchenfrage geraten: „Nun sag, wie hast du’s mit dem Döner, Brauner?“ Mehr oder minder originäre Schnellimbisse und multinationale Franchises bieten ihren Konfektionsmampf mittlerweile alle paar Meter an. Die meisten ihrer Stammkunden sind Argumenten für eine zuträgliche Ernährung längst entwöhnt – oder nie zugänglich gewesen. In Abermillionen missachteter Kindheiten wurde und wird der Nachwuchs bequemlichkeitshalber mit industriell hochverarbeiteten Lebensmitteln und Fastfood abgespeist. Das mag Gen Y und Z insoweit entschuldigen, dass deren Gewohnheitsfrettchen ihre geschundenen Geschmacksknospen erst gar nicht entwickeln konnten. Oder ein bekömmliches Maß irgendwo zwischen McFlurry und einem Bucket liegengelassen haben.
Dabei müsste selbst ein unverbesserlicher Pizzafreund für moderate Selbstfürsorge durchaus nicht von morgens bis abends Rohkost mümmeln. Wer aber kaum den Unterschied zwischen Discounterpizza und einem großherzig belegten Holzofenteigling schmeckt, ist gar nicht mehr so weit weg vom kulinarischen Anspruch einer Schmeißfliege. Der ein frisch ausgeschissenes Steak bekanntlich so recht ist, wie ein rohes oder gekonnt gebrutzeltes.
Komm mir bloß nicht wieder mit dem Surbel, eine augewogene Ernährung sei wesentlich eine Frage finanzieller Möglichkeiten. Sie sollte vielmehr Konsequenz persönlicher Prioritäten und eines Einstehens für sich selbst sein. Die Entscheidung für Lebensmittel, die dieser Zuschreibung auch würdig und wert sind, ist in jeder Preisklasse problemlos möglich. Selbst für ein Meeresfrüchterisotto auf Gemüsebett zahlst du in einer gutgeführten Trattoria selten mehr als für zwei Schachteln Zigaretten. Und zu den Kosten einer selbstgemachten Gemüsesuppe mit Einlage kriegst du wahrscheinlich nicht mal ein Gramm Dope – oder ’ne trinkbare Pulle Fusel.
Um nachhaltige Kontrolle über das eigene Dasein zurückzugewinnen, solltest du allerdings mindestens imstande sein, den Zusammenhang zwischen einer labberigen Grundhaltung und dem Nicht-Scheißen-Können herzustellen.