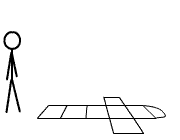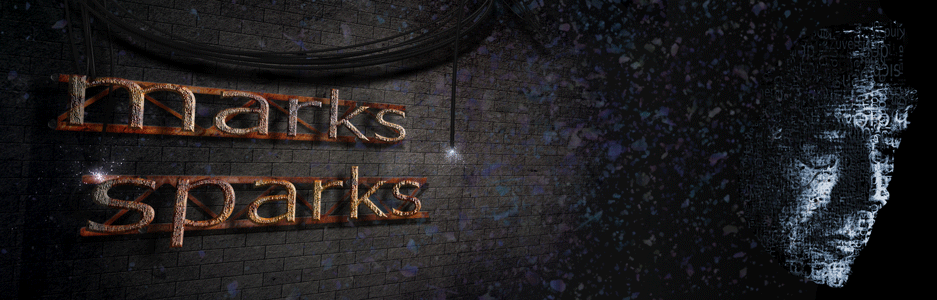Ein Auszug aus meiner Novelle „Agnieszka“ , entstanden 2007 und ebenfalls der Novellensammlung mit dem Arbeitstitel „Mleczarnia“ zugehörig
Viel zu lange hatte ein strenger Frost Osteuropa im Griff gehabt. Noch Anfang März trieb Eis, nicht wenige der Schollen groß wie ein halbes Fußballfeld, behäbig die Weichsel hinab. Indessen machten administrative Obliegenheiten einen Besuch in Deutschland unumgänglich. Wie Josph Roth einmal sehr treffend feststellte, ist der Mensch ohne Papiere kein Mensch. Allerdings war ich keineswegs gewillt, der Verwaltung meiner Identität mehr als eine Woche zuzubilligen.
In der gewesenen Heimat auch von den Freunden nicht vergessen worden zu sein überraschte mich, obwohl ich dahingehend gänzlich ohne jede Erwartung war. So schienen mich selbst jene vermisst zu haben, welche mich vor zwei Jahren ziemlich doch eher erleichtert verabschiedet hatten.Nun nahm beinahe jeder Anteil daran, wie es mir in der Fremde erginge. Andernorts nahm man mich gar wie einen verlorenen Sohn auf, so selbstverständlich, wie man das eigene Kind in die Arme schließt. Ihm, erleichtert über dessen reuige Rückkehr, nur vom Besten vorsetzt.
So machte es allein die eigene Rührung über soviel Zuwendung unmöglich, auch nur eine der zahlreichen Einladungen auszuschlagen. In Anbetracht der offenbaren Freude wäre es zudem mehr als unhöflich gewesen, diesen Langmut noch länger zu strapazieren. Schließlich waren aus der ursprünglich geplanten Woche an Rhein und Neckar also doch deren drei geworden.
Auf dem Rückflug phantasierte ich mich in einen milden Krakauer Vorfrühling, fieberte mit dem idealisierenden Sehnen des Verliebten meiner Wahlheimat entgegen. Bald schon trieben die Bäume an der Planty aus, der Rynek werde wieder aufgeräumt in der Morgensonne glänzen, weit und licht, beinahe menschenleer noch.
Womöglich werde dort ein einsamer Fiaker warten. Den Kragen hochgeschlagen, eingenickt hinter der furzenden Dickarschigkeit und dem muskelzuckenden Dampfen seines Kaltbluts, das mit ruhigen Augen erwartungslos in den Morgen glotze. Vergessen vom Vorabend noch stünde das aufgeputzte Gespann oder harre – zeitig ausgerückt, in der pflichtbewussten Zuversicht einer frühen Fuhre. Es dufte nach der ländlichen Wärme eines Pferdestalls, nach Hafer, Stroh und Lederzeug, nach dem Schmierfett der Achsen. Vielleicht dufte es schon nach Magnolienblüte. Sicher röche es nach dem Schlafdunst einer Großstadt.
Unmerklich belebe sich schließlich die statische Aufgeräumtheit. Mit auf- und ab schaukelnden Schulranzen zunächst, deren hoffnungslos unterproportionierte Eigner, Konfetti und Knallerbsen unterm schlafwirren Haar, womöglich einem nachsichtigen Tadel für eine spielvergessene Schularbeit entgegenhampelten.
Als habe man sich stillschweigend einvernommen, fülle sich das Pflaster endlich mit den bequemen Tretern kulturbeflissener Zeitgenossen, dem gedeckten Schnürwerk pressanter ‚Biznesmen‘. Nicht zuletzt mit jenem leichtfüßig sicheren Stöckelstakkato der, vor meiner Abreise noch wintertrauriger, jungen Frauen, welche an einem untergehakten Frühlingsabend ihre sonnigen Lächeln endlich wieder gefunden haben mochten.
Mindestens ein Dutzend dieser Lächeln wolle ich mir Tag für Tag selbst gutschreiben und umgehend zurückzahlen, nahm ich mir fest vor. Insbesondere jedoch freute ich mich auf liebgewordene Menschen, setzte mich gedanklich mit den gewohnten Themen im Mleczarnia auseinander.
Das Mleczarnia im Stadtteil Kazimierz ist meine Stube in Krakau. Ich darf behaupten, diese sei mir insbesondere in Phasen innerer Entfremdung vertrauter, als die eigene Wohnküche am Salwator. Die angenehm distanzierte Vertrautheit mit anderen Stammgästen und den Bedienungen insbesondere, verhilft mir selbst an melancholischsten Tagen dazu, den Blick immer auch nach vorne zu richten.
So trinke ich meinen nachmittäglichen Tee regelmäßig in der Krakauer Vorstadt , eine liebgewordene Gewohnheit, welche ich einst für meine innere Behaglichkeit von den Inseln Albions importiert habe. An optimistischeren Tagen gestehe ich mir zudem einen oder zwei eiskalt gekippte Wodka zu, obwohl ich einem angewärmt genippten Cognac jederzeit den Vorzug gebe. Begründe die zweischneidige Selbstbelohnung meist nicht sehr überzeugend damit, schließlich auch lokalen Gepflogenheiten Reverenz erweisen zu müssen.
Über mir das Kobalt einer erdfernen Atmosphäre, alle irdischen Jammertäler vermeintlich unter uferlosen Wolkengebirgen begraben und zehn Kilometer weg, dachte ich an Dominika. Dominika, die Filmregisseurin mit dem fatalen Hang zum Detail und einem beneidenswert akzentfreien Englisch – Dominika, die stets ein spöttisches Lächeln um den energischen Mund hat und die Welt mit großen dunklen und neugierigen Augen beobachtet.
Wenn Dominika nicht gerade ein neues Projekt plant oder an einem Skript arbeitet, schneidet sie auf dem Notebook ihre ausgesprochen avantgardistischen Kurzfilme. Produziert jeden ihrer Plots selbst, stellt die Ergebnisse auf den jährlich wiederkehrenden Filmtagen in der gesamten Republik vor.
Mein respektvolles Staunen ermunterte sie einmal zur ganzen Wahrheit. In Ermangelung spalierstehender Schaulustiger sei auf dergleichen Veranstaltungen ein roter Teppich verzichtbar. Auch fielen die Buffets durchaus spärlicher aus, als man das etwa aus Fernsehberichten über das alljährliche Schaulaufen in Cannes oder von der Biennale her kenne.
Bei jenen zyklischen Ereignissen und insbesondere bei der gegenseitigen Begrüßung gebärde sich freilich jedermann geradeso überschwänglich, wie die Akteure auf jenen bekannten Festivals. Jeder tue, als sei der jeweilig Begrüßte einer, ohne den das eigene Dasein unweigerlich unerträglich und leer bleiben müsse.
Regisseure wie Darsteller zelebrierten sich gegenseitig, mimten also in Ermangelung desselben auch das hochverehrte Publikum. So bestimme schließlich der eigene Horizont den Anspruch des Claqueurs an die selbstverfertigte Kunst. Diese Misere nötige die Protagonisten jener Filmfeste in der Provinz zudem, das andernorts oft gering geschätzte Genie wechselseitig wortgewaltig zu streicheln, wolle man nicht unablässig in fundamentaleren Selbstbetrachtungen absaufen.
Ansonsten päpple man die auf den Künstlercorpus geschneiderten Neurosen, pflege also in erster Linie schon mal vorausschauend den erstrebten Nimbus. Präsentiere die zwischenzeitlich in Bits und Bytes rechnende Phantasie mehr kokett verschämt, so en passant halt. So sei auch der ausbleibende kommerzielle Misserfolg leichter zu verschmerzen, welcher aus Sicht des ambitionierten Kunstschaffenden ohnedies als fragwürdig anzusehen sei. Nichts weniger scheine es trotzdem immer ein bisschen so, als schiele da eine Parade der Verkannten neidisch auf ebenjene Fortune, welche sie so obenhin abwerte.
Stefan schaut auf einen Espresso herein. Jene fünf Hektoliter Wein, welche er vor Monaten in Südafrika in der Zuversicht auf einen feinen Gewinn erwarb, haben zwischenzeitlich zwar den Bestimmungsort Krakau via Kopenhagen erreicht. Unterdessen versauere die Ladung vom Kap schon seit Wochen im Zolllager. Wenn das so weitergehe, sei die ganze Soße tatsächlich bald Essig. Selbst die Zollmarken für jede einzelne Flasche habe er vor ein paar Tagen in Warschau persönlich quittieren müssen.
Das Geschäft mit Alkohol sei die reine Katastrophe, wiehere der Amtsschimmel im Polen des Postkommunismus offenbar munterer als sonstwo auf der Welt. Seine gesamte Existenz werde noch in diesem vermaledeiten Wein absaufen, wehklagt Stefan und hetzt davon, der vergorenen Zeit nach, um einem Umkippen des Rebsaftes möglicherweise doch noch zuvorzukommen.
Im Mleczarnia ist nicht nur die Begeisterung der unverhofft Fündigen ein andauerndes Déja vu. Die Meisten suchen sich selbst im nostalgischen Ambiente auszustellen. Dabei ähneln viele der Posen bereits erlebten auf verblüffende Weise. Zunächst schieben sich Wortwolken in- und übereinander, Regieanweisungen, einschläfernde Szenenwechsel. Blitzlichtgewitter. Geschmeicheltes Getuschel. Gelächter. Gleichwohl inszeniert sich diese lässlich liebenswerte Eitelkeit nur in einer Chimäre der Vergangenheit. Tatsächlich stellt nämlich das Mleczarnia nichts als fingierte Historie dar – bleibt nur vermeintliche Erinnerung – oder fortgesetzter Neuronenkurzschluss zur Einkehr. So ist selbst seine Ehrwürde erschlichen. Was soll’s aber – desto unbekümmerter pfeift sich’s auf Authentizität – do dupy.
Zudem besitzt diese Insel der Gelassenheit offenbar die unbegreifliche Eigenart sich entdecken und bejubeln zu lassen, um anschließend abermals in die Dünen einer versandenden Vergesslichkeit einzusinken. Wie anders ließe sich sonst erklären, dass kaum einer der so euphorisch Gestrandeten noch einmal anlandet.
Weiters scheint die Kavarnia auf eine nach innen gerichtet schläfrige – oder traumverlorene Weise noch anderlei Gesetzmäßigkeit zu trotzen. So weist kein Zunftschild oder eine Reklametafel darauf hin, dass sich hinter dem vorhanglosen Fensterglas ein öffentliches Lokal verberge. Nur eine ausgemusterte Bahnhofsuhr über der Eingangstür lenkt den Neugierigen, weist einem möglichen Sich- Erinnern den Weg, aber als ob auch diese Uhr das verbindliche Zeitmaß durchaus ignorieren wolle, verweilen ihre Zeiger auf einer Minute vor Zwölf. So scheitert auch jede Veränderung an sanftem Stillstand.
Bisweilen trabt eine kleinere, meist fremdsprachige, Herde in die nachmittägliche Beschaulichkeit. Verharrt scharrend und stühlerückend im ansonsten schattigen Schweigen. Es scheint, als ertrüge die Unrast keine Stille. Blättert bienenfleißig in ihren Reiseführern, biographiert in spe – memoriert in summa. Vermag noch jede Magie des Augenblicks ins Banale zu schwafeln. Transportiert unablässig fußhohe Einsichten elektromagnetisch in alle Welt, tauscht summend sich aus. Ist flatternde Vorschau, ist tremolierende Reminiszenz, ist ängstlich vermiedene Einkehr seit je. Ist affektiv bereits wieder sonstwo, bevor das Organische selbst sich anschickt, weitere Gipfelpunkte der Stadtgeschichte zu erklimmen.
Verstörend indiskret, ungeniert und gedankenlos reißt so eine weltläufige Rastlosigkeit im Vorbeihasten ab, was sie bereits am nächsten Tag meist nicht mehr zu erzählen weiß. In den helleren Jahreszeiten nimmt die Frequenz dieser Irritationen zu, im Winter ebbt sie ab.
Nun hatte ich allerdings nicht vor, mich eingehender mit diesen Absichtslosen, den Getriebenen oder Sporadischen zu befassen, vielmehr soll an dieser Stelle die Geschichte eines eher unscheinbaren alten Mannes erzählt werden.
Seit Jahren betritt dieser täglich, so versicherten mir jedenfalls die Bedienungen übereinstimmend, bei jeder Witterung schlag vier Uhr das Mleczarnia und verlässt es ebenso zuverlässig um Sechs wieder. So scheint er überhaupt der einzige Anwesende zu sein, welcher sich zumindest auf den ersten Blick ein Gefühl für Pünktlichkeit oder Beständigkeit bewahrt zu haben scheint. Sein Anzug ist überall ein wenig zu großzügig bemessen, erinnert mich an meine eigene Kindheit, als das Geld knapp war und ich die zweifach abgewetzten Hosen meiner älteren Brüder aufzutragen hatte.
Der Mann mag seinen Zweireiher zu einer Zeit erworben haben, als es noch Usus war, in den Amtsstuben und Kanzleien dieser Welt Weste und Jackett zu tragen. Unruhig schaut er immer wieder auf eine goldfarbene Sprungdeckeluhr, eine freilich schon recht abgeriebene Halbsavonette, wie ich einmal im Vorbeigehen bemerken konnte – schaut also auf diese Uhr als fürchte er, einen wichtigen Termin zu versäumen.
Klein geworden und bescheiden, beinahe demütig sitzt dieser Mann am immer selben Tisch, nippt gedankenverloren an seinem Kaffee. Mir ist nicht erinnerlich, ihn je etwas anderes trinken gesehen zu haben. Meist geht sein Blick aus dem Fenster. Indessen bin ich mir ziemlich sicher, er sieht ins Leere und verweilt in Erinnerungen. Zuweilen zuckt etwas über sein Gesicht, mag von einem tiefwurzelnden Seelenschmerz oder einem schleichenden Gebrechen herrühren. Niemals wendet er sich einem anderen Gast zu, auch wird er selbst nicht angesprochen. Die Scheu vor soviel augenscheinlicher Verletzlichkeit hielt auch mich stets davon ab, vielleicht ein Bröselchen Gegenwart oder einen Krümel Erinnerung zu erhaschen, ihm gar eine feine Geschichte abzuringen.
Jeder Gruß, ja schon ein aufmunternde Zunicken prallt an ihm ab – und also hat es den Anschein als bestünde die vornehmste Lebensaufgabe dieses Mannes nachgerade darin, sein empfindsames Innenleben zu schützen oder sich selbst zu verpuppen. Selbst die Bestellung seines Kaffees besteht nur aus einer lautlosen Mundbewegung, einem hilflosen Blick. An einem besonders traurigen Tag in seinem langen Leben mag dieser Mensch sich versprochen haben, fortan stumm und ganz für sich zu sein.
Als das Flugzeug in einen holpernden Sinkflug überging, schreckte ich aus meinen Gedanken hoch und blickte aus dem Bullauge. Über Schlesien und Kleinpolen lastete eine tonlose Totenglocke, nahtlos gegossen aus gesättigten Regenwolken und metallträchtigen Emissionen.
Wie silbergraue Schattenrisse einer vor vielen Jahren schon verlorenen, puppenstubigen Kinderseligkeit wanden sich schließlich die regenglänzenden Dachhäute der behäbigen Kaufmannshäuser im Gassengewinkel der Altstadt, das spitzgieblig Vieltürmige der Marienbasilika, die Zinnen und Kuppeln der Tuchhallen aus dem Dunst.
Indes mich der engbestuhlte Airbus auf dem Rollfeld aus meiner Nachdenklichkeit und in den verhangenen Nachmittag spie, vermerkte ich gleichwohl nicht ohne Genugtuung die Erfüllung meines ersten Begehrens. Mild war es endlich geworden, der grimmige Winter hatte sich offenbar endgültig in seine Heimat davongemacht.
Da vielen Reisenden erfahrungsgemäß spätestens in der Empfangshalle die elementarsten Instinkte durchgehen und ich das unerfreuliche Geschiebe und Gedrängel am Förderband der Gepäckausgabe von jeher aus tiefster Seele verabscheue, reise ich seit Jahren selbst im tiefsten Winter ausschließlich mit leichtem Gepäck.
Es scheint mir vertretbarer, ein paar Tage mit einer veritablen Erkältung das Bett zu hüten, als mir zehn unendliche Minuten fortgesetzt auf den Zehen herumsteigen – oder mit scharfkantigen Rollwägelchen gar die Achillesfersen ramponieren zu lassen.
Indes hat es den Anschein, als schütze mich gerade ebendiese, durchaus nicht unfatalistische Einstellung vor grippalen Infekten, habe immerhin meinen Körper mit jedem hin- und her unempfindlicher oder gar immun werden lassen. Jedenfalls vermag ich mich nicht zu erinnern, in den letzten Jahren mit dergleichen Verdrießlichkeiten geschlagen gewesen zu sein.
Mit meinen drei Habseligkeiten vermochte ich auch die Zollkontrolle gewohnt unbehelligt zu passieren. Auf dem Weg zum Taxistand begann es zu nieseln. Der Taxifahrer, unvermeidliche Vorhut einer jeden größeren Ansiedlung, wittert in meiner Reisegarderobe wohl den vermeintlich spendablen Touristen. Ignoriert geflissentlich eine, sich vor mir sich ächzend abmühende, schwer bepackte Kleinfamilie. Weicht dieser, sich dräuend auf ihn zuknäuelnden Verdichtung aus Menschenleibern, Koffern, Tüten und Täschchen mit jener füchsischen Finesse aus, welche das umtriebige Vollblut vom gelegenheitstaxelnden Philosophiestudenten unterscheidet.
Das Familienoberhaupt hatte sich eben anschicken wollen, den Fahrpreis nach Górka Narodowa zu verhandeln. Der Angesprochene stellt die Lauscher auf Durchzug, nutzt geschickt eine Bresche im Geknäuel, pfeilt auf mich zu und bleckt dabei das goldgespickte Gebeiß dermaßen begeistert, als habe er einen tot geglaubten – oder wenigstens ewig entbehrten Weggefährten wiedergefunden.
Zupft mir mit einer versiert vorschnellenden Rechten meine übersichtliche Habe aus der widerstandslosen Hand und hält mir im nächsten Augenblick mit der Linken undhastenichtgesehen bereits serviceorientiert den Schlag zum Fond des Wagens auf.
Ich schäme mich, derart unverdient bevorzugt worden zu sein – schlage, ob meiner schamlos ausgestellten Wehrlosigkeit die Fondtür missmutig wieder zu, allerdings nicht ohne der langgesichtig verharrenden Sippe immerhin ein zerknautschtes „Przepraszam“, ein polnisches Pardon also, zugeraunt zu haben. Dann erst falte ich meine Einsneunzig seufzend auf den Beifahrersitz.
Der Fuhrmann scheint ansonsten nicht verkehrt. Ein munterer Bursche der Sorte, welche am liebsten sich selbst zuhört. So folgt er dem eigenen Zwang nicht nur zu transportieren, sondern den ihm Ausgelieferten auch pausenlos mit Bedeutungslosigkeiten zu penetrieren.
In langen Jahren des Vagabundierens habe ich mir längst die Professionalität angeeignet, bei Bedarf selektiv zuzuhören und dergleichen auditiven Flächenbombardements lediglich die notwendigste Aufmerksamkeit zu schenken. Zuweilen zu nicken oder eine vage Antwort zu brummeln erscheint mir Zuwendung genug, betrachte ich als Beifahrer die Welt doch zwischenzeitlich ohnedies lieber aus dem Seitenfenster. Suche noch immer nach Akzeptanz für eine Perspektive, die mir noch immer so nahe geht und ist doch schon ein halbes Menschenalter her.
Der harte Winter sei in geschäftlicher Hinsicht ein besonderer Glücksfall für seinesgleichen gewesen, käut es unterdes neben mir wieder, vermutlich das fünfte Mal an diesem Tag. Das gleichförmige Geplauder verliert sich in Aussichten auf einen mindestens ebenso einträglichen Touristensommer und verlief sich endlich auch in meinen eigenen Gedanken.
Eine gänzlich überraschende Ansicht bot sich mir, als der bereits angezählte Audi über die Grunwaldzkibrücke rumpelte. Erklärend muss ich an dieser Stelle einfügen, dass einstige Baumeister im Stadtbereich auch der Weichsel ihre eigene Ordnung aufgezwungen haben. Seinerzeit war Kazimierz, das einstige Judenquartier, noch eine Insel. Der zweite Arm der Weichsel befand sich auf Höhe der heutigen Jozefa Dietla, jenes Boulevards, welcher zwischenzeitlich die Trennungslinie zwischen der Altstadt und dem ehemaligen Getto markiert.
Seit dem späten 19. Jahrhundert windet sich die Weichsel einem scharf umrissenen Bett einbahnig durch die Stadt, massive Uferbefestigungen aus nahtlos aneinander gefügten Granitquadern halten an den meisten Tagen des Jahres immerhin auf der Altstadtseite das Wasser davon ab, etwa vorsätzlich oder wie von ungefähr über das sonntägliche Schuhwerk von sorglosen Spaziergängern zu schwappen.
Der Wärmeeinbruch hatte zwischenzeitlich wohl auch höher gelegene Gebiete der Beskiden und der Tatra erreicht. Die heftige Schneeschmelze flussauf ließ die gewohnte Geometrie des Weichselbettes in ihren Umrissen verschwimmen.
Selten darf die Uferpromenade einem nahezu statisch metallischen Glänzen folgen, diesem Schliff, in dem sich das Wolkenlose eines heiteren Himmels zu spiegeln vermag. Das sind die Tage, an denen die Seele segeln darf. Meist schreibt der Wind Krauses ins Wasser. An solchen Tagen gibt es nur einen Himmel. Zuweilen aber verschließt sich selbst das Unermessliche dem Sehnen nach Weite. Geahnt ist dann das Himmelsblau nur, oder erinnert. Vermauert sich auch das gefällige Erinnern, bleibt nur, das Gegenwärtige gewähren zu lassen. Alle Tristesse unbewertet bei sich zu dulden, als sich zugehörig anzunehmen gar. Sich widerstandslos treiben zu lassen.
An diesem Tag aber schäumte und strudelte, brodelte es aus den südlich gelegenen Gebirgen heran, wälzte sich eine schlammtrübe braune Brühe einem, noch weit entfernten, einem endlos lichtblauen Horizont über der baltischen See entgegen – dem geträumten, nicht gewussten. Wenigstens die Weichsel beanspruchte an diesem Tag also die Ausschließlichkeit des Ganzen, wollte die Anarchie, war ausschließliche Gewalt, stellte das ungespiegelt Promenadenlose vor.
Selbst die stählernen Tore der mächtigen Hochwasserschutzmauer habe man zum Schutz der tiefer gelegenen Stadtteile vorsichtshalber geschlossen, untertitelte derweil der Taxifahrer das Sichtbare, nachdem er zuvor genüsslich eine teerschwangere Schwade seiner ovalen ukrainischen Kozak aus den geblähten Nüstern hatte quellen lassen. Immerhin lupfte er in der Meiselsa die Tasche eigenhändig aus dem Kofferraum, winkte mir bei der Abfahrt gar jovial zu. Der offenkundige Mangel an geistig anwesender Subvention schien seine offenbar unkomplizierte Gemütsstruktur also weiter nicht gestört zu haben.
****
Es mochte gegen halb fünf gewesen sein, als ich das Mleczarnia betrat. ‚Zu Hause endlich, dachte ich angesichts der sichtlich aller Schwerkraft enthobenen Elfe hinter dem Tresen verzaubert. Gosias Lächeln flitterte mir entgegen, feenhaft, silbern, unausweichlich, ein Stanniolschauer entwaffnender Anmut. Um nicht lange um den Brei zu reden: ich liebe Gosia. Ich liebe sie, wie man eine unwiderstehliche Illusion liebt oder eine wehmütige Erinnerung. Ich bete ihre beinahe unwirkliche Schönheit an, wie man die Schönheit einer wahrhaftigen Göttin anbetet. Ich vergöttere dieses ätherische Wesen. Verehre sie ohne eitle Erwartungen oder menschliche Anmaßung, bin ihr abseits frivoler Phantasien und banaler Begierden zugetan. Zuweilen ist mir gar, als ob mir in ihrer Gegenwart eigene Flügel wüchsen. Entsprechend glücklich also strahlte der innere Peter Pan zurück.
Ich plauderte ein paar befreite Minuten mit Gosia. Beneidete für einen virilen Augenblick Felipe, einen Pressefotografen, um dessentwillen sie ein polnisch-portugiesisches Wörterbuch angeschafft habe. Im Juni wolle sie diesen Felipe in Lissabon überraschen, indem sie ihm ihre Zuneigung in seiner eigenen Muttersprache gestehe.
Das unheilbar Romantische bestärkte Gosia beifällig in ihrem beherzten Entschluss, indes die erfahrungslastigen Zweifel, einer zu häufig getretenen Realität wegen, bedenklich, aber unsichtbar ihren Augen, den Kopf wiegten. Ich wünschte ihr also, gleichfalls unausgesprochen, jene rührende Liebeserklärung werde dem Beneidenswerten auch im portugiesischen Sommer noch immer das Nämliche bedeuten. Möge in seinem Latinoherzen nicht klang- und belanglos verhallen und womöglich als banale Fremdsprachenübung eines aschblonden Krakauer Vorfrühlings ihr tränenzerflossenes Ende finden.
Erst nachdem ich mich häuslich eingerichtet hatte bemerkte ich, dass doch etwas fehle. Vielleicht ließ mich die angenommene Tatsache oder vielmehr meine zu selbstverständliche Erwartungshaltung annehmen, er müsse einfach dort sitzen, als dass ich seine Abwesenheit sogleich bemerkt hätte. Jedenfalls war der gewohnte Platz des alten Mannes am Fenster unbesetzt. Ich überlegte, ob ihm etwas zugestoßen sei, erwog die Möglichkeit, er könne erkrankt oder von einem Auto angefahren worden sein. ‚Vielleicht hat er einfach nur eine seiner Gepflogenheiten aufgegeben‘, mutmaßte ich eben, als die Eingangstüre sich öffnete und der Vermisste eintrat.
Grau sah er aus, noch eingefallener das schmale Gesicht als sonst. Auch schien heute etwas Unerklärliches, ein beunruhigend Metaphysisches mit ihm hereingeweht worden zu sein, vergleichbar am ehesten mit einem fahlen Nebelgespinst, wie es in winterlichen Auen oder über aufgelassenen Totengärten durch die kahlen Weiden kriecht.
Jäh drang eine kaltsüßliche Klammheit, wie sie nur ein verfaulender Organismus auszudünsten vermag, auf meine ungeschützten Sinne ein. So unerwartet kam jenes Ausatmen der Verwesung über mich, dass ich ihm wehrlos ausgeliefert war. Mir war, als dringe diese kalte Fäulnis in mich ein, wolle mich gänzlich ausfüllen, Besitz von mir ergreifen. Für einen süßen Augenblick brachte ein jahrelang erstickter Kummer Kopf und Herz in seltenen Einklang.
Es schien, als müsse sich da ein Mensch in einem abgestorbenen Atemzug wie in einem filzenen Überwurf verfangen haben, der Ahnung eines einsamen und frostkalten Todes, wie er in einer Winternacht zuweilen von stehendem Gewässer her über die schlafende Stadt streicht.
Gegen alle sonstige Gewohnheit, sich umgehend an seinen Tisch zu begeben, hielt der alte Mann plötzlich inne. Mit einer Hand sein Kinn bedeckend sah kurz in meine Richtung, bestellte schließlich mit einem Nicken in Gosias Richtung den üblichen Kaffee. Daraufhin trat er entschlossen an meinen Tisch. Mit einer knappen, beinahe militärischen Verbeugung stellte er sich vor. Ich war so perplex über sein unerwartetes Verhalten, dass ich aus einem Reflex heraus aufsprang und mit einer ebensolchen Verbeugung meinen eigenen Namen nannte.
„Wenn sie sich zu mir setzen wollen“, lud ich ihn mit einer Geste ein, die nichts mit mir zu tun haben schien.„Ich weiß nicht ob ich recht daran handle, sie zu stören, aber habe sie oft beobachtet“, sagte er, als er Platz genommen hatte „und mir war zuweilen, als könnten sie mein Sohn sein, so oder ähnlich habe ich ihn mir jedenfalls stets vorgestellt.“
„Ich fürchte, ich verstehe sie nicht ganz“, antwortete ich, befangen über diese gleichfalls überraschende Eröffnung, „wer als sie sollte besser wissen, wie ihr eigenes Kind aussieht“. Bitterkeit schien ihre scharfen Krallen in seine Erinnerungen zu schlagen, wieder lief dieser Ausdruck von unsäglichem Schmerz über seine Gesichtszüge. Er trank hastig ein paar Schlucke Kaffee, setzte die Tasse geräuschlos auf dem Unterteller auf.
„Missverstehen sie mich bitte nicht“, fuhr er gefasster fort, „ich wollte damit nur ausdrücken, er wäre etwa in ihrem Alter und immer meinte ich, er müsse dunkelhaarig und schlank sein, wie seine Mutter. Aber wie komme ich überhaupt dazu, sie mit alten Geschichten belästigen zu wollen. Sie haben ohnedies zu tun, wie ich eben erst bemerke. Bitte entschuldigen sie meine Unhöflichkeit.“
Er deutete auf ein aufgeschlagenes Manuskript, schüttelte verwirrt den Kopf, erhob sich und wollte sich zum Gehen wenden.„Aber so bleiben sie, erzählen sie, ich bitte sie herzlich“, hielt ich ihn zurück, brachte gleichsam meine Besorgnis zum Ausdruck, so kurz vor dem Ziel um meine lang gehegte Hoffnung gebracht zu werden.
„Ich werde sie gewiss langweilen“, bemerkte er trübe, während er sich erneut auf der Kante des Stuhls niederließ, „zudem darf ich nicht verhehlen wie verhängnisvoll es sein könnte, mich einem anderen Menschen mitzuteilen. Es ist eine Geschichte, die beinahe ein halbes Jahrhundert her ist. Sie passt also schwerlich in diese Zeit. Dennoch ist mir zuweilen, als sei sie erst gestern geschehen, als laste diese ungeheure Schuld noch immer mit ihrem ganzen Gewicht auf mir.“ Bei diesen Worten sah er mich mit den Augen eines hilflosen Kindes an.
„Vielleicht erleichtert es sie, wenn sie darüber reden“, suchte ich beflissen, nicht eben originell und noch weniger uneigennützig, Vertrauen aufzubauen, „zumal ja nie verkehrt sein kann, womöglich auch einmal eine andere Sichtweise dazu zu hören .“
„Da ich kaum eine weitere Gelegenheit finden werde, meine Geschichte einem Menschen anzuvertrauen, will ich sie also ihnen erzählen. Ich werde mich bemühen, nicht zu weitschweifig zu werden, muss allerdings ein wenig ausholen, damit die Zusammenhänge klar werden“. „Verfügen sie gerne über meine Zeit“. Ich nickte ihm noch einmal aufmunternd zu …