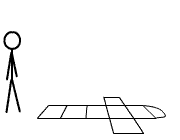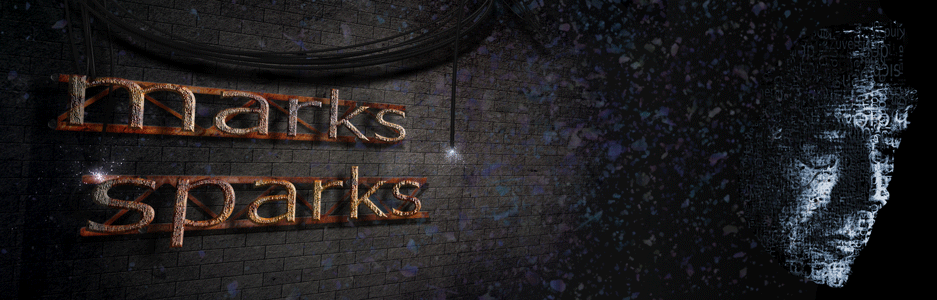Dieser Text entstand Mitte 2005, also kurz nachdem ich nach Krakow übersiedelt war. Die Wohnungssuche gestaltete sich schon damals schwierig, wenn man eine Bleibe in der Altstadt oder in Kazimierz suchte. Heute etwas Bezahlbares in einem dieser angesagten Quartiere zu finden, sei schlichtweg ausgeschlossen, wie mir Freunde jüngst versicherten.
Einmal bist du schon hier gewesen. Über zwanzig Jahre ist das her. Damals schien dir diese Stadt noch ein Stück wiedergegebene Kindheit. Museale Trambahnen, regenglänzendes Kopfsteinpflaster, schwermütig dahintropfende, nebelgraue Nachmittage. Die Mehrzahl der Autos nicht viel größer als Hutschachteln. Die auf Zweckmäßigkeit ausgerichtete Bekleidung einerseits. Das offenbare Geschick der weiblichen Bevölkerung andererseits, selbst aus Wenig stets ein wenig mehr zu machen. Die stets gleiche Sorte Schutzfolie in den Schaufenstern. Bräunlich verfärbt, wellig und trübe geworden durch die Sonneneinstrahlung. All das ist haften geblieben – wie die beizenden Emissionen der Braunkohlefeuerung. Ein Geruch, den du in deinem ganzen Leben nie mehr vergisst.
Herznote der Erinnerungen blieb – vor allem anderen, stets ein sanftes Lächeln. Jenes Lächeln, das doch ausschließlich dir selbst galt. Unreif warst du und lebenshungrig, verspieltest jenes Lächeln an nur einem mürrischen Morgen allzu leichtfertig.
Blitzblank sonnt sich der Rynek Glowny, Osteuropas größter Marktplatz in der Maisonne. Kariertes Schulmädchenplissee und pastellfarbene Leibchen, mindestens einmal zu oft durch den Kochwaschgang gestolpert. Entenschnütchen und lasziv langwimprige Augenaufschläge. Spätestens nach dem zehnten Bauchnabelpiercing trollt sich aber auch die letzte hormongesteuerte Phantasie gelangweilt.
Was weiter? Touristenglück, allenthalben aufgeräumte Mienen. Feiertäglich aufgeputzte Zweispänner, welche auch wochentags auf zahlungskräftige Klientel warten. Fliegende Händler und statische Illusionen. Edelleute in Brokatgewändern, ein mürrischer Eremit, der Narr auf dem Thron und der Tod in Sack und Asche. Ein apfelbäckiges Kind hascht riesige Seifenblasen. Max und Moritz, die hier Jacek und Placek heißen, ködern arglose Tauben mit Brezeln zu 90 Groszy.

Aber auch das! Wirtschaftliche Not, die sich im Schatten der Mariacki bettelnd über die Runden bringen muss. Alte Menschen mit grauen Gesichtern. Die sich die Almosen zunehmend mit jenen professionellen Bettelbanden teilen müssen, die sich für den Luxus ihrer Clanchefs organisiert durch Europa schnorren. Womöglich hat das jugendlich berauschte Herz dergleichen Realitäten seinerzeit ausgeblendet.
„Weshalb denn ausgerechnet in den Ostblock?“, hatten nicht wenige geargwöhnt, als ich im ausgehenden Winter meine Vorstellungen ausbreitete. „Ostblock“ Schmeckt nicht allein die Vokabel wie eine salzlose Soljanka aus der Kombinatsküche von Robotron? Perlt wie lauwarmer Krimskoje in der Kellerbar eines Interhotels? Rasselt so melodisch wie Panzerketten auf dem Roten Platz und verzaubert wie die Aussicht auf Aktivurlaub im Gulag?
Die Mehrzahl der Kollegen phantasiert naturgemäß vom Süden, von einem ewigen Sommer und feinsandigen Stränden an einem türkisfarbenen Meer. Beinahe jeder spielt allwöchentlich Lotto. Ob aber ein Haupttreffer allerdings jene Träume tatsächlich auch aufblühen ließe? Ich traue mich immerhin, spreche ich mir Mut zu. Schiebe geflissentlich von mir, dass ich mich nur aus dem Staub mache. Versuche, auch vor mir selbst auszukneifen.
„Ich träume eben davon“, beharre ich gleichwohl, erinnere mich jenes melancholischen Lächelns. Das Lächeln bleibt freilich bei mir. Stattdessen füge ich an, dass Polen doch immerhin Mitglied in der EU sei, als sei schon diese Tatsache Rechtfertigung genug für meinen Entschluss. „Nimmst du dein Auto mit?“, erkundigt sich schließlich ein Grinsen. Ich verneine hastig, weil ich die verschlissenen Witzeleien nicht mehr hören kann.
Die alte Königsstadt an der Weichsel ist mir wärmende Erinnerung und nähere Zukunft gleichermaßen. Eine Woche bleibt, ein Dach über dem Kopf zu finden. Die barocke Bürokraft im Studentenbüro erkundigt sich barsch, wie sie mir weiterhelfen kann. In diesen Räumlichkeiten sind Boomer sichtlich Ausnahme. Mit einmal wird mir klar, dass ich mir da ein Dasein zueignen will, dem ich längst entwachsen bin. Trage, entsprechend unsicher geworden, meine Wünsche vor.
„Ich hätte da etwas, ein Häuschen mitten in der Stadt“, feldwebelt sie. Selbst ihr Konjunktiv scheint keine Widerrede zuzulassen. „Ich verfüge über recht begrenzte finanzielle Möglichkeiten“, wage ich gleichwohl zaghaften Widerspruch. Meine Einrede bürstet sie im kategorischen Imperativ ab. Das Haus sei überschaubar, also erschwinglich. Das „Basta“ verkneift sie sich vermutlich nur angesichts meiner bereits angegrauten Schläfen.

Könnte besser nicht losgehen. Meine Phantasien gaukeln mir ein strohgedecktes Hexenhäuschen mit azurnen Fensterläden vor. Inmitten eines verwunschenen Gärtleins warte dieses Kleinod seit hundert Jahren darauf, von mir wachgeküsst zu werden. Schlaftrunken noch, schlüge ich allmorgendlich das satte Blau dieser Fensterläden schwungvoll auf. Begrüße mit einem dezenten Winken die schöne Frau Nachbarin, die eben ihre hauchzarten Dessous auf der Leine aufreihte, während Höschen und Mieder von einer frivolen Windböe just an den richtigen Stellen gebeutelt würden. Ein lauerer Wind wiege sanft die ungemähte Blumenwiese hinter dem Haus.
Der Kirschbaum trüge im Juni sattes Herzrot. Inmitten echten Seidelbasts, Buschwindröschen und Anemonenseligkeit gedeihe auch die Inspiration wie von Zauberhand. Es dufte nach Sommer und Liebe. Ohnedies sei andauernd Sommer. Die Liebe fände sich. Selbstvergessen spielende Kinder, allabendlicher Austausch nachbarlicher Neuigkeiten am verwitterten Staketenzaun. Ich sehe mich schon jätend in meinem kleines Paradies. Petersilie werde ich wohl anpflanzen, Dill, Majoran, Radieschen sicher – ich liebe Radieschen. Tomaten vielleicht. Erdbeeren sowieso. Ansonsten darf die Natur walten.
Im ersten Stock eines Wohnblocks aus der Gründerzeit empfängt mich grazil großmütterliche Grandezza. Eine wirkliche Dame öffnet den Abschluss. Eine Dame von der Art, wie sie einem heutzutage nur noch aus der gezackten Distanz raschelnder Fotoalben oder knistrigen Schwarzweißfilmen entgegensehen. Reicht mir anmutig ihr durchsichtiges Händchen. Hat sich festgesessen in rappeldürrem Rokoko.
Ich will dieses Kleinod im eigenen Park um jeden Preis und gebe alles. Mime den Max von Welt. Parliere gestelzt wie einer, der in den Herrenhäusern Europas ein- und ausgeht. Schwebe mit halber Arschbacke über einem fragilen Sitzmöbelchen, um nicht dessen Totalverlust zu riskieren – und mich simultan zur Wurst zu machen. Ermahne mich unentwegt, die Zweitbrühung eines undefinierbaren Beuteltees weder zu schütten noch zu schlürfen. Nippe folglich mit abgespreiztem kleinen Finger, wie ich es im Fernsehen in einer Schmonzette von Pilcher mal gesehen habe. Jongliere einen Steinzeitkeks in der Linken – handgetöpfert offensichtlich. Ertrotze dergestalt eine zirkusreife Leistung der Körperbeherrschung.
Eigentlich kann eine Dame, die Tee aus recycelten Beuteln und Restkekse von ihrer Einschulung kredenzt, gar keine wirkliche Dame sein. Nichts weniger ignoriere ich die untrüglichen Indizien der Knickrigkeit. War und bin stets ein unverbesserlicher Träumer – und werde immer einer bleiben. Zwar bin ich wieder einmal ohne Gretel am Start, aber selbst bei einem GAU, wenn sich nämlich das Traumhäuschen als Pfefferkuchenhaus erweisen sollte, kann ich ja immer noch die Beine in die Hand nehmen. Die vierzig Kilo Hexe renne ich einfach über den Haufen, wenn sie mir blöd kommt. Genug der markigen Gedanken. Zeit, mein künftiges Anwesen in Augenschein zu nehmen. Pani Czarownica führt mich durch das muffige Treppenhaus in ein finsteres Hinterhofgeviert.

Dort duckt sich ein gewesener Geräteschuppen weinerlich zwischen himmelhohe Hausmauern. Schmiegt sich hilfesuchend an rissiges Backsteingrau. Steht diesem womöglich stützend bei. An der Frontseite klafft eine Schießscharte, die prahlerisch das einzige Fenster vorstellen soll. Die Innenarchitektur schlägt schließlich alles. Geradeso mag man sich hinter dem Eisernen Vorhang den Charme eines Chalets ausgemalt haben. Jede verfügbare Senkrechte ist mit Nut und Feder verbarrikadiert. Fichte – auf Eiche rustikal gequält. Die karge Schlafstatt und ein schmuckloses Nachtkästchen, aus siechem Sperrholz beide, runden das prickelnde Ambiente klausnerischer Bußfertigkeit ab.
„No tak“, nickt mir die Dame überraschend keck zu, „bis vor wenigen Tagen hat hier noch eine Japanerin gelebt“. Hat sie tatsächlich „gelebt“ gesagt? Ihre Prahlerei schwebt zwischen uns im Raum, hartnäckig wie ein unziemlich stehengelassener Bierfurz. Die Weltläufigkeit seiner gewesenen Bewohner soll mich offenbar endgültig von der Wertigkeit der Herberge überzeugen. Buddhistin das beklagenswerte Geschöpf, mutmaße ich zerstreut. Im Stadium einer komatösen Moha womöglich, oder im beharrlichen Kotau vor ihrem Karma.
Mein betretenes Schweigen scheint die Dame als sprachlose Verve zu werten. Leitet folgerichtig umgehend zum geschäftlichen Teil über. Tausend Zloty pro Monat. Plus Nebenkosten. Die ganze Plempe beliefe sich dann auf dreihundert Euro. Begeistert nickt sie noch einmal in Richtung dieses materialisierten Alptraums, scheint etwas völlig anderes wahrzunehmen als ich. Soll ich lachen, muss ich weinen? Dreihundert Eier für die runtergeranzte Farce einer Kartause. Selbst für Tokioter Verhältnisse unstrittig ein Fall von Mietwucher. Ich hätte nicht übel Lust, der Dame gehörig die Meinung zu geigen.
„Aber man sieht ja nicht einmal den Himmel“, scharre ich schließlich die letzten Reste Respekts vor dem Alter zusammen. Würge zumindest halbherzigen Widerspruch aus mir. Winde mich sehnsüchtig dem Licht entgegen. Das Vorderhaus wächst, pränatale Traumata auslösend, kaum drei Meter vor meinen Augen in die Unendlichkeit.
„Dafür hört man aber die Vögel singen“, bemerkt die Dame mit jenem nasalen Unterton, in dem manche Erwachsene vermeintlich begriffsstutzige Kinder zu belehren pflegen. Tatsächlich randalieren ein paar Sperlinge im Hof. „Jetzt ist sie komplett durchgeschmort“, lästert es in meinem Schädel. Da aber lächelt die alte Dame milde und geheimnisvoll – lächelt, wie nur wahrhaftige Grandezza zu lächeln versteht.