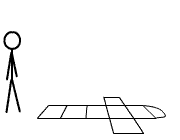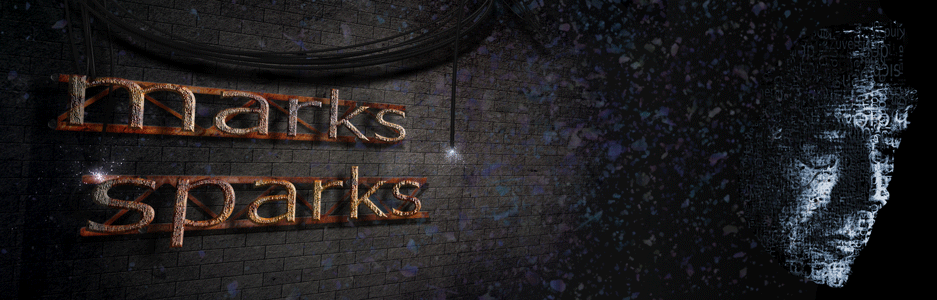Bleicher Februarmorgen in der Vorderpfalz. Eine Blaumeise zetert im Wipfel des kahlen Apfelbaums. Aus einem geöffneten Fenster am Dorfrand nudelt Schlagermusik. Allein – der mürrische Winter will noch nicht aufgeben. Kristallisation blockt Inspiration. Damit kann ich leben. Schalte ab, setze meine Schritte fokussiert. Hin und wieder stellen sich ein paar Erinnerungen ein. Suchen halbherzig und zerstreut nach Zusammenhängen, zerfleddern – wieder einmal. Werden beziehungslos und unangetastet ins abermalige Vergessen geweht.
Dann geschieht doch etwas. Zunächst ist nur ein gleichförmiges Brummen zu hören, dessen Lautstärke gleichmäßig zunimmt. Mit dem Näherkommen wird das typische Stakkato eines Boxermotors daraus. Von Westen her nähert sich ein gelber Doppeldecker, der zu einem kühnen Looping ansetzt. Womöglich probt der Pilot für einen großen Auftritt. Jäh und schmerzhaft reißt dieser Impuls den Schorf von einer nie verheilten Wunde.
Von Beginn an war mir die Schule suspekt. So ackerte ich mich eher unmotiviert von Buchstabe zu Buchstabe und durch die ersten zwei Schuljahre. Lernte unvermeidlich Lesen und Schreiben wie meine Mitschüler, versuchte mich mit mäßigerem Erfolg in Rechnen und Weitsprung. Wäre gleichwohl gerne länger im Kindergarten geblieben, weil ich schon damals ahnen mochte, dass es der mentalen Hygiene zuträglicher wäre, sich in eigenen Fantasien zu verlaufen, als in den Realitäten und Erwartungshaltungen anderer. Die Welt lässt dir freilich selten eine Wahl.
Meine, hingebungsvoll gemalten, lila Pferde, Kaninchen und Portraits nahm die Lehrerin zum Anlass, meine Mutter einzubestellen, um sich mit ihr über meinen Geisteszustand auszutauschen. Gegen äußere Anwürfe erwies sich Mutti, mit der schon ansonsten nicht gut Kirschen essen war, stets als wahre Löwenmutter. Selbst Tochter eines, pedantisch strengen, Lehrers empörte sie insbesondere, dass eine Pädagogin offenbar nicht begreifen konnte, dass Lila für ihren zerstreuten kleinen Professor, wie sie mich so liebevoll wie ratlos nannte, einzig akzeptable – und keinesfalls diskutable Lieblingsfarbe war.
Obwohl wir häufig aneinandergerieten, ahne ich heute, dass ich für meine Mutter schon deshalb speziell war, weil sie nie wirklich schlau aus den Grillen in meinem Kopf wurde. Lebhaft zu träumen verstanden wir beide. Ihre hochfliegenden Lebensentwürfe waren freilich längst an Realitäten zerschellt, während sie in meinem Wirrkopf noch gründlich Wellen schlugen. Jedes ihrer Geschwister hatten studieren dürfen, während sie den Familienhaushalt führen musste, weil ihre eigene Mutter kränkelte. Die Erkenntnis, dass sich ihr Leben so ganz anders entwickelt hatte, als in ihren Jungmädchenträumen, machte sie einigermaßen unberechenbar. Aus der Distanz der Jahre kann ich ihre Launen leichter nachvollziehen. Ich meine, was kann dich gnatziger machen, als geklaute Träume?
Das dritte Schuljahr begann, aber die Rahmenbedingen hatten sich nicht eben verbessert. Ich saß nun als einziger der ganzen Klasse alleine in meiner Bank, weil mein bester Freund lieber Pauls bester Freund sein mochte – und folglich seinen Sitzplatz an dessen Seite fand. Als Arbeiterkinder waren sie von der AWO nach Schapbach „auf Erholung verschickt“ worden, wie man das damals nannte. Womöglich hatten sie sich dort Blutsbrüderschaft geschworen. Das war, der Winnetoufilme wegen, in den frühen Sechzigern schwer in Mode.
Die älteren Brüder durften bereits ins Kino und berichteten wichtig und sachverständig, wie’s gemacht wurde. Vor dergleichen Barbareien drückte ich mich allerdings schon aus Unverständnis. Nicht nur, dass mir keineswegs einleuchten wollte, warum man sich zum Beweis gegenseitiger Zuneigung selbst zu verletzen hatte. Im Grunde war mir der ganze Indianerkram viel zu physisch.
Mich trieben im Zusammenhang mit Cowboys und Indianern eher praktische Fragen um. Wo beispielsweise ein Old Shatterhand abprotzte, wenn er mitten in der baumlosen Prärie mal ganz nötig musste. Ob er eine Rolle Klopapier oder alte Zeitungen in der Satteltasche mitführte, oder ob er sich die Furche einfach mit Gras auswischte, oder was eben grad so greifbar war. Ob und wie er danach die Hände wieder so sauber bekam, dass er Winnetou oder Nscho Tschi anstandslos die Hände schütteln konnte. Wie er geräuschvoller Flatulenzen Herr wurde, während er ein Komantschenlager beschlich, oder ob er sich beim Beschleichen aufs ausschließliche Entweichenlassen von Schleichern zu beschränken verstand.
Ohnehin schienen Helden wie Schurken nie zu müssen und mich wunderte, dass das außer mir keinen zu stören schien. Einfach jeder musste doch regelmäßig – ich selbst immer besonders nötig, wenns gerade spannend wurde. Und was konnte spannender sein, als nachts ein Indianerlager zu beschleichen? Indes war kaum vorstellbar, dass die Tipis der Belauschten über Klos verfügten. Ein extra Klozelt? Ganz seltsamer Gedanke. Die Rothäute nutzten für ihre größeren und kleineren Geschäfte vermutlich jeden Busch, der einigermaßen Sichtschutz bot. Und verminten nach und nach die ganze Gegend, bis sie die Jagdgründe wechselten und der Kreislauf von vorn begann.
Wie kommst du aber als Späher mit deiner makellosen Fransenlederjacke bei Nacht und Nebel bäuchlings kriechend durch diese Minenfelder? Ich erinnere ein sehr individuelles Kino im Kopf, während ich die Filmplakate und Szenenbilder in den Schaukästen des Vorstadtkinos „Olymp“ durch meine dicken Brillengläser studierte. Es widersprach einfach meiner damaligen Lebenserfahrung, dass man in irgendwelchen Gebüschen rumkroch und trotzdem immer geschniegelt und wie aus dem Ei gepellt daherkam. Sechzig Jahre später kann ich immerhin zugestehen, dass selbst im seriösesten Film der Spannungsbogen durch allzu viel Authentizität oder Detailverliebtheit abschlaffen müsste.
Während der großen Ferien hatten sich meine Mutter mit dem Augenarzt darauf verständigt, mein linkes Auge über satten sieben Dioptrien zuzupflastern, um dem rechten das Schielen auszutreiben. In der Rückschau womöglich eine notwendige, wenngleich nicht unbegrenzt nachhaltige, Maßnahme, aber wenn du eh schon ziemlich weit unten in der Hackordnung rangierst, kannst du sowas überhaupt nicht gebrauchen. Ein paar angeklebte Schlappohren hätten die gebeutelte Selbstachtung auch nicht trefflicher auszustellen vermocht. Kurz – ich war nun noch verlassener, aussätzig und preisgegeben.
Einige Wochen später, ich hatte mich zwischenzeitlich zwangsläufig im zyklopischen Alleinsein eingerichtet, betrat der Rektor mit einem ausnehmend grazilen Persönchen unsere Klasse. Er stellte das Mädchen knapp vor, Christianes Familie sei von da und dort zugezogen – und überließ es der Lehrerin, ihr einen Platz zuzuweisen. Diese sah etwas unschlüssig in meine Richtung, deutete schließlich auf den einzig freien Stuhl im Klassenzimmer. Fügte tröstend an, sobald neben einem Mädchen frei würde, dürfe sie sich gerne dorthin setzen. In der Klasse machte sich Unruhe breit, Kichern – schließlich hatten doch Mädchen neben Mädchen zu sitzen. Feuerrot und schwitzend rutschte ich hinter meinem Pult hin und her, Paria einmal mehr. Währenddessen forderte die Lehrerin unsere neue Mitschülerin auf, der Klasse ein bisschen über sich selbst zu berichten.
Das Woher und Warum habe ich längst vergessen. Was sich hingegen im Gedächtnis einbrannte war das: Der Vater sei Ingenieur, gar Erfinder. Verhaltenes Raunen in der Klasse. Als genüge diese kühne Behauptung für sich noch nicht, beteuerte sie schließlich mit jenem überbordenden Stolz, den kleine Töchter gern für ihre Väter hegen, Papa sei zudem ein bekannter Kunstflieger. Auf skeptische Nachfrage der Lehrerin antwortete sie ganz selbstverständlich: „Na, das Flugzeug gehört natürlich uns, es ist unser eigenes“. Schon begannen die Ersten zu kichern, bald stimmte beinahe die ganze Klasse in das Gelächter ein.
Die einen lachten vielleicht aus Fremdscham. Andere, weil sie ohnehin keine Gelegenheit ausließen, die sich zum Gackern bot. Missgünstigere Naturen meckerten entsprechend gehässig. Christiane stand einfach nur da, stumm, erschreckt und jählings irgendwie zerzaust. Ließ das Gemecker, ließ die Häme widerstandslos auf sich abregnen. Hatte was von einem Piepmatz, der plötzlich aus dem Nest gefallen- und mit der Situation völlig überfordert ist.
Die Lehrerin, eine ansonsten vom Pflichtgefühl durchdrungene, grauhaarige kleine Frau mit einem festen Dutt, war sichtlich ebenfalls aus dem Konzept. Schüttelte schließlich unschlüssig – womöglich missbilligend den Kopf – ob nun der forschen Behauptung, oder des allgemeinen Gegackers wegen? Vermutlich wusste sie das selbst nicht so genau. „Es ist gut, mein Kind“, beließ sie es schließlich jovial dabei, wies nochmals auf den leeren Platz, wandte sich ab und wieder Kreide und Tafel zu.
Ich gehe davon aus, dass der eine oder andere Vater von heute ein eigenes Flugzeug im Hangar stehen hat. Zwar kenne ich niemanden, der eines besitzt, aber das hat nichts zu bedeuten. Mit der gleichen Stetigkeit, in der sich die grauen Haare vermehren, verlaufen sich auch die Bekannten. Zudem hat es in diesen Tagen ungleich mehr Väter mit dicken Brieftaschen als damals noch – und selbst für schmalere Börsen befiehlt der Zeitgeist, doch einfach zu leasen. Warum sollte Leasing nicht auch für Sportflugzeuge möglich sein – selbst für solche, mit denen sich kühne Kunststücke fliegen lassen könnten?
Vor reichlich über einem halben Jahrhundert aber – und da trug sich diese Geschichte zu, schafften die Väter aus unserem Viertel – jene Väter also, die ich kannte – als Vertreter, Maurer oder Kraftfahrer ran, verdienten ihre Brötchen als Metzger, Klempner oder auch Apotheker. Viele buckelten beim Benz am Band. Die Frühschicht machte sich schon vor halb sechs mit dem Rad auf den Weg. An der Lenkstange klöterte der Henkelmann mit Eintopf, nach Vorliebe – oder Liebe – mit einer mehr oder minder herzhaften Einlage.
Nach Feierabend kloppten dieselben Väter ein paar Runden Skat, andere wurstelten im Garten oder gingen angeln. Fast alle ließen ihre Sprösslinge beim DJK oder beim SC 1910 triezen. Nicht wenige sicherlich schon deswegen, weil sie wohl insgeheim darauf hofften, der eigene Nachwuchs möge über mehr Talent und flinkere Beine verfügen, als sie selbst. Samstagnachmittags pilgerten sie gewöhnlich in kleinen Grüppchen auf den Fußballplatz, um ihre Investition und deren Fortschritte zu kontrollieren – oder um den Schiedsrichter anzuschreien.
Bedächtigere zelebrierten ihr Feierabendbier wie eine Andacht in der Wohnküche, während sich andere gedankenlos Granaten und Kurze in den Hals schütteten, bis sie lallend vom Stuhl kippten. Noch maßlosere vermöbelten im Surbel regelmäßig Angetraute und Ableger, weil sie Schuldige für das Scheitern der eigenen Zukunftsträume brauchten – und der Alkohol längst Realität und Anstand zersetzt hatte. Weil sie als Familienoberhäupter traditionell Recht behalten mussten, auch wenn ihnen die Frau in wesentlichen Belangen turmhoch überlegen war. Weil ihnen das Muster in der Tapete stank, oder ihre Erbärmlichkeit im Suff noch sichtbarer wurde. Manchmal alles zusammen.
Der dicke Bernd hatte niemand, zu dem er Vater sagen konnte. Er ging als einziger nach der Schule in den Hort, weil seine Mutter von früh bis Nachmittag Nylons in einer Strumpffabrik kettelte. Sein Sitznachbar hatte es noch schlechter getroffen. Toni hielt verzweifelt an seinem Glauben fest, der Storch habe ihn versehentlich fallen gelassen. Deshalb wohnte er vorübergehend bei den Nonnen im Kinderheim, bis seine Eltern eines Tages zu ihm fänden.
Mein eigener Vater, der wochentags im Blaumann Autos reparierte, sah in seinem Tagwerk vermutlich Sinn und Notwendigkeit. Er wollte es so und nahm den Montag hin, wie den Freitag. Als Meister hatte er sich ein halbes Jahr darin ausprobiert, im örtlichen Automobilwerk Aufgaben zu verteilen, oder die Einhaltung von Fertigungstoleranzen zu überwachen. Er ließ es, weil ihn das nicht zufriedenstellte. Weder lag ihm am Kommandieren, noch vermochte er einer Kontrolltätigkeit irgendeine Zufriedenheit abzugewinnen. Überhaupt verließ er sich gern auf sich selbst. So bedeutete ihm die trügerische Sicherheit einer organisierten Masse nichts. Er war nicht aus dem real existierenden Sozialismus abgehauen, um sich im Kapitalismus substanzfernes Betriebsratsgewäsch anzutun. Für ihn waren Gewerkschaftler der gleiche Menschenschlag wie jene knöchernen Funktionäre, die sich ohne Parteibuch und Arschkriecherei niemals über Qualifiziertere hätten emporschwingen können. Die Chef spielen durften, ohne irgendeine fachliche Eignung zu haben – oder unternehmerische Risiken eingehen zu müssen. Dieser Mann hatte keine Ambitionen, vor der Welt zu glänzen, er sah weder Gewinn darin, besonders sein – noch zu scheinen und machte auch nie ein Gewese um seine Autorität, von der ohnehin etwas sehr Selbstverständliches ausging.
Vati, der mit seinen beiden Brüdern zu Zeiten allgemeiner Rezession selbst vaterlos aufgewachsen war, erzählte wenig aus seiner Kindheit. Einmal erwähnte er eine Badehose, die ihm seine Mutter aus Resten abgetragener Socken genäht hatte. Ich erwartete eine lustige Pointe, er aber sprach vom Gelächter der anderen Kinder, von seiner Scham und der Ohnmacht des Ausgeliefertseins. In solch seltenen Momenten wurde mir bewusst, dass er allzu heftige Gemütsbewegungen lieber hinter Selbstdisziplin verbarg, als sich verletzbar zu zeigen. Fussball kam in seinen seltenen Anekdoten niemals vor. Er lernte auch erst im späten Erwachsenenalter schwimmen, als man ihm die Rentenkasse eine Kur bewilligte. Dieser späte Triumph über seine kindlichen Ängste machte ihn stolz.
Nur hin und wieder beschäftigte ihn noch der Krieg. Freilich suhlte er sich keineswegs in seinen Kriegserinnerungen, wie so viele Väter, die ins Schwärmen gerieten, wenn ihnen nach Selbstbestätigung und Gefühlsduselei war. Ich erinnere mich an einen Nachbarn, der es, so eben halbwüchsig, wohl gerade noch in den Volkssturm geschafft hatte, seine vielfältigen Husarenstreiche aber besonders gern ausschmückte. Nach seiner Lesart hatten nur wenige richtige Männer von seinem Schlag gefehlt, um die Kriegswende doch noch herbeizuführen. Seine Räuberpistolen hatten durchaus ihre Fans, mich stießen die schlecht erfundenen Roheiten ab.
Überhaupt hatte es viele Männer, die das betreute Denken ihrer eigenen Kindheit so gebrochen hatte, dass sie sich ausschließlich in Freund-Feind Schablonen zurechtfanden. Die auch zwanzig Jahre nach der kapitalen Bruchlandung imperialen Größenwahns hoffnungslos überfordert damit waren, die fatalen Konsequenzen von Gleichschaltung und Vermassung für eine individuelle Lebensfreude zu begreifen. Die ihr Untertanentum bis in ins Knochenmark verinnerlicht hatten, toxischen Männlichkeitsidealen anhingen und stereotyp von Opferbereitschaft, Kameradentreue und famosem Gemeinschaftsgeist zu schwadronieren begannen, wenn sie erst mal in Fahrt kamen. Die noch immer kein Problem damit hatten, einen zynischen Eroberungskrieg zum unbezahlbaren Abenteuer umzudichten – und denen sanktionierte Gewalt und militärische Gehorsamspflicht als wohlfeile Erklärung für Abstumpfung und Bestialität zu genügen schien.
Unserem Vater hatte nie daran gelegen, Ehre im Kampf zu gewinnen. Er träumte von einem Leben, von einer Frau, von Kindern. Welchen Sinn macht es, die eigene Zukunft für eine Idee – für weniger noch, für Eroberungsgelüste und Machtfantasien von Emporkömmlingen aufs Spiel zu setzen? Was hatte ihm Antoine aus Arras getan, was den Traktoristen Sergej zu seinem Feind machen können? In Vati war nicht einmal angelegt, Feinde zu haben – warum sollte er sich Feindbilder aufschwatzen lassen? So suchte er wohl noch bestmöglich zu individualisieren, als längst Entzivilisation befohlen war.
Es gelang ihm, auch in dieser rechtlosen Zeit nicht allzusehr mit seinen eigenen Wertmaßstäben durcheinander zu kommen – und seine tiefe Gläubigkeit zu bewahren. Ein Rechtschaffener der, wollte man seinen Erinnerungen Glauben schenken, (und ich hatte nie Veranlassung, ihm nicht zu glauben) einer russischen Bäuerin ihr Huhn lieber abkaufte, oder etwas brauchbares dafür eintauschte, statt es ihr nach Herrenmenschenmanier einfach wegzunehmen und der zeternden Frau als Bezahlung womöglich den Gewehrkolben in die Untermenschenvisage zu rammen.
Rückschläge nahm er hin, ohne seinen Gott in Frage zu stellen. Vielleicht duldete er ja auch ganz gerne, wer kann das wissen? Glaubt schließlich nicht jeder, jenen Himmel verdienen zu können, auf den er hofft? Vorstellbar, dass er, wie einst Hiob, seinem Gott insgeheim für jede Plage dankte, die ihm der Herr prompt freigiebig auf den Buckel lud. Jener Gott, der ihm nach seiner Lesart auch im Krieg seinen Platz zum Überleben schon zugewiesen hatte. Bei der Instandsetzung hatte er neben Kübelwägen auch Panzer zu warten und reparieren. Die hernach wieder russische Gehöfte, Bauersfrauen oder Hühner in Brand schießen konnten, wenn man das zu Ende dachte. Bis in die letzte Konsequenz durchdachte er unangenehme Szenarien eher nicht. Womöglich hätte das seine Überzeugungen dann und wann doch ein wenig in Unordnung gebracht.
Beinahe zwei Jahrzehnte nach dem Krieg gab er nach Werkstatt und samstäglich noch stundenlang den Fahrlehrer. Auf der Suche nach einem bescheidenem Wohlstand oder auf der Flucht vor dem häuslichen Zirkus. Denkbar ist beides. Jedenfalls bekamen ihn die Kleineren meist überhaupt erst Samstags nach der Wanne zu Gesicht, wenn sie selbst nach Seifenlauge – und die ganze Wohnung wunderbar nach warmem Streuselkuchen oder Bienenstich rochen. Sonntagnachmittag wurde sich des Backwerks gemeinsam angenommen.
Hin und wieder gings im Fahrschulwagen runter zum Rhein, in die Vordepfalz oder ins Weschnitztal. Auf dem Beifahrersitz hielt Mutti die Jüngste im Arm, während die Orgelpfeife versetzt im Fond klemmte. Wie heute war mir aufgezwungene Nähe schon als Kind außerordentlich unangenehm. Konnte diese drangvolle Enge tatsächlich aufwiegen, zwei, drei Stunden Frachtschiffen nachzuträumen, flache Steine über Wellen zu fitschen, oder einen Staudamm zu bauen? Schon als Kind fand ich nie eine zufriedenstellende Antwort.
An gutgelaunten Tagen ließ uns unser Vater auf unbefahrenen Nebenstraßen oder großen Parkplätzen ans Steuer, während er die zusätzliche Pedalerie vom Beifahrersitz aus betätigte. Welch ein überwätigendes Gefühl. Bedeutete doch der Platz hinter dem Lenkrad eigenverantwortlich zu handeln und Sorge für die Sicherheit eines Passagiers zu tragen. Für wenige Minuten in eine zukünftige Rolle zu schlüpfen. So mochte sich Erwachsensein anfühlen, das jedenfalls glaubte ich damals. Vati verstand meine Begeisterung immerhin soweit, dass er selbst Autonarr war. Zur Ruhe kam er praktisch nie. Wollte zumindest in seiner Freizeit jedem gerecht werden – und ignorierte dabei sicher oft eigene Bedürfnisse.
Damals hatten nicht wenige der Klassenkameraden Geschwister satt. Drei oder vier Kinder waren eher Regel als Ausnahme. Selbst über eine noch zahlreichere Kinderschar wurde ungleich seltener die Nase gerümpft als heutzutage. Das Teilen hat mir nie etwas ausgemacht. Als evidentestes Manko, viele Geschwister zu haben, empfand ich stets die fehlende Privatsphäre. Nie hatte man seine Ruhe, einer rückte einem immer auf den Pelz. Ein eigenes Zimmer bekam ich viel später, etwa mit fünfzehn. Gott, ich war so glücklich darüber. In den frühen Sechzigern reichte es bei vielen Familien finanziell so eben für das Notwendigste. Für Arbeiterfamilien mit einem Verdiener war selbst ein Kleinwagen noch unerschwinglicher Luxus. Vom eigenen Boot oder gar Flugzeug konnte selbst bei Apothekers überhaupt nicht die Rede sein.
Christiane hatte beteuert, ihr Vater sei Kunstflieger mit eigener Maschine. Was offenbar die halbe Klasse lachhaft fand. Die Reaktion meiner Mitschüler war mir unbegreiflich. Was konnte am Staunenswerten lächerlich sein? So hatten mich nicht nur ihre Behauptungen nachhaltig beeindruckt, vielmehr war ich von der gesamten Situation berührt. Wie das Mädchen allein gegen fremde Kinder stand, verletzlich, beschützenswert und zum Gespött geworden. Dieses Bild wollte mir auf dem ganzen Heimweg nicht aus dem Kopf. Da es auch mit meiner Selbstbehauptungskraft damals nicht eben weit her war, beschloss ich, Christiane nicht nur zu glauben, sondern ihr auch jene Zuneigung entgegenzubringen, die ich mir als Kind selbst schon so schroff versagte. Zu beschützen, obwohl ich mich selbst so schutzlos fühlte.
Wie trivial konnte selbst der Nimbus eines Erfinders gegen die großartige Fantasie von der Kühnheit eines wahrhaftigen Kunstfliegers sein? Vor Aufregung konnte ich keinen klaren Gedanken fassen. In meiner naiven Birne barsten bunteste Bilder. Da sprühte und knatterte es wie ein fulminantes Feuerwerk, das einem aus Fahrlässigkeit schon in der Transportkiste um die Ohren fliegt.
Das Abtrocknen des Geschirrs, dessen Erledigung eigentlich einem festgelegten Wochenplan unterlag, übernahm ich an diesem Nachmittag freiwillig. Das brachte immerhin ein paar wertvolle Minuten, um meine Mutter angelegentlich nach bekannten Kunstfliegern ausfragen zu können.
Selbstredend setzte ich die harmloseste Miene auf, die ich draufhatte, damit sie den Braten nicht roch. Verkniff mir jede Erwähnung unserer neuen Mitschülerin, obwohl ich diesen Umstand naturgemäß für die Sensation des Jahres hielt. Mutti erinnerte sich an den roten Baron und an Udet. Von denen war schon zu ihrer Schulzeit die Rede gewesen. Dann war da noch Göring, der war wohl auch ganz ordentlich geflogen, als er noch nicht zu dick für eine kleine Maschine war. Dessen erinnerte sie sich aber eher als aufgeblasene Uniform mit pfundweise Lametta – und drogensüchtig war der – das traute man sich aber erst nach dem Krieg laut zu sagen. Natürlich konnten mich ihre Auskünfte in keiner Weise zufriedenstellen. Ich entschied, dass keiner der drei zu Christiane passte. Da musste es schon noch ein paar mehr geben, von denen meine Mutter nicht wusste.
Von Stund an ging ich gern zur Schule. Verbrachte vor dem Frühstück Zeit vor dem Spiegel. Versuchte mit Zuckerwasser die schlafwirren Haare zu bändigen, mit denen ich vorher doch ohne Weiteres in der Schule aufgeschlagen war. Den Tipp hatte ich von Roger, der schon in die Mittelschule ging. Heute würde man vielleicht sagen, Roger war schon eine verdammt coole Sau. Zumindest schob er eine höchst eindrucksvolle Bugwelle vor sich her. Roger das Einzelkind, dessen Eltern meist genug mit sich selbst zu tun hatten. Roger, der zwei Häuser weiter wohnte, während der Mittagsruhe in seinem Dachzimmer regelmäßig bei offenem Fenster Trompete übte und Elvis verehrte.
Meine Mutter, die sich von jeher bestens aufs Erfinden illustrativer Wortschöpfungen verstand, konnte Roger allerdings nicht die Bohne riechen. Der kaute – oder knätschte, wie sie es nannte – nämlich unablässig Kaugummi – und das mit sträflich offenem Mund. Damit nicht genug, rotzte er zudem fortgesetzt aufs Trottoir, eine wenig appetitliche Unart, die seinerzeit hierzulande noch nicht sehr verbreitet war. Wie er beide Angewohnheiten unter einen Hut brachte, blieb ein Mysterium für mich. Womöglich hatte er sich den Kniff bei irgendwelchen GI’s abgeguckt und für seine Belange modifiziert.
Diese Kindergesichter aus Übersee schwärmten stets in Grüppchen aus, wenn sie Ausgang bekamen. Viele walkten die nachgiebigen Klümpchen nachdrücklich – und sehr augenscheinlich – zwischen den Backenzähnen, während sie eine glimmende Winston im Mundwinkel balancierten. Damit kamen die Bürschlein schon ziemlich lässig rüber. Das wird Roger gefallen haben und da er mit zwölf oder dreizehn nicht rauchen durfte – oder wollte, ersetzte er die Lulle vielleicht kurzerhand durch sein ständiges Gerotze. Ich habe aber nie nachgefragt, ist also nur so eine Idee.
Nichts weniger finde ich die üble Angewohnheit ungenierten Absonderns diverser Sekrete heute so abstoßend wie damals. Musste Roger andererseits einfach dafür bewundern, dass er einen ziemlichen Dreck auf die Meinung Erwachsener gab. Während ich heute so über all das nachdenke, mein ich, er müsse auch Unmengen getrunken haben, um seinen Speichelhaushalt dermaßen auf Trab zu halten.
Als Endzwanziger transportierte Roger, unbeirrbare Haartolle noch immer, seine Frühstücksbrötchen mit einer 67er Impala ab. Sorgte an lauen Abenden mit den offenen Tüten an seiner gestrippten Panhead für Furor im Viertel. Mit Vierzig fuhr er das Bike schon weit seltener aus. Die Impala war längst nicht mehr auf Show gebohnert und in der nachlässiger geformten Tolle zeigten sich erste graue Strähnen. Ein knappes Jahrzehnt später hatten sich auch die letzten Fans verlaufen und mit ihnen wohl endgültig der Sinn seines Lebens.
Die Harley sorgte längst anderswo für großes Hallo und der gewaltige Straßenkreuzer korrodierte, kaputt und nutzlos geworden, unter einer Plane im elterlichen Garten seiner endgültigen Bestimmung entgegen.
In den ersten Jahren des neuen Jahrtausends besuchte ich Roger noch hin und wieder in seiner kleinen Werkstatt, wo er Fernseher und Radios reparierte. Da roch es dann schon vormittags gewaltig nach Fusel und viel zu erzählen gab es auch nicht mehr. Es schnitt mir ins Herz, wenn er mutlos, verlottert und mit leerem Blick vor einem kaputten Radio saß, wie vor dem eigenen Scherbenhaufen. Wie er beinahe trotzig jene schnoddrigen Sprüche aus seinem Gedächtnis klaubte, mit denen er früher im Dauerfeuer um sich geballert hatte.
Nicht selten brach dann der ganze schal gewordene Bombast, beziehungs- und substanzlos geworden, nuschelnd aus ihm heraus – und einem seiner spärlichen Besucher vor die Füße. Noch vor Ablauf einer halben Stunde begann sein Blick immer häufiger in Richtung jenes Schranks zu irrlichtern, in dem er neben seinem Werkzeug wohl auch den Schnaps aufbewahrte. Roger war im Schraubstock seiner Sucht gefangen – und nicht mal mehr Schatten seiner Erinnerungen. Sein Dasein begann sich nachgerade aufzulösen. Diesen kapitalen Verfall ansehen zu müssen, tat schon gemein weh.
Wenige Jahre später, ich hatte mittlerweile eigene Gespenster hinter mir gelassen und lebte andernorts ein ganz anderes Leben, ist Roger dann ziemlich konsequent an einer Leberzirrhose eingegangen. Da war der letzte Rock ’n‘ Roll Akkord längst verstummt und das kraftvolle Blubbern des mächtigen V-Twin bestenfalls verschwommenes Echo einer ungezähmten Vergangenheit. Auch der fette Chevy war mittlerweile auf platten Reifen unter seiner Plane verfault – ganz wie ein barmherzig verhülltes Denkmal abgesoffener Leitbilder. So endete das mit dem wilden Roger, der stets Alles wollte – und von allem zu viel.
Aber das war ungefähr vierzig Jahre später. Unsere Geschichte spielt in den Sechzigern. Ich ging in die dritte Klasse, und Roger rockte noch als unumstrittener Macker im Viertel. Zumindest bei uns Jüngeren. Mittlerweile experimentierte ich mit der fettigen Frisiercreme aus Vatis roter Tube, da sich der selbstgemachte Zuckerwasserfestiger als nicht regenfest erwiesen hatte. Mit dieser Schmiere ließ sich auch der widerborstigste Wirbel an die Birne kleben. Außerdem brachte ich einen Friseurwechsel ins Spiel, weil der alte Schillinger im Bäckerweg nur einen Schnitt im Repertoire hatte, der weder Wirbel noch Haarwuchsrichtung berücksichtigte.
Der Mann hatte sein halbes Leben nichts als Kommissköppe getrimmt, bei denen ausschließlich Zweckdienlichkeit und Preis-Leistung zählten. Bei einem Landser muss jeder „Faconschnitt mit Bombage“ zwangsläufig rausgeschmissenes Geld bedeuten. Selbst die schnittigste Fönwelle hat unter einem Stahlhelm keinerlei Beifall zu erwarten. Auch in der Frisurfrage forcierte ich Rogers Referenz, ohne freilich dessen Namen zu erwähnen, damit Mutti nicht sofort auf stur schaltete. Wenn ihr was gegen den Strich ging konnte sie, ich deutete es bereits an, richtig kiebig werden. Stets galt es entsprechend diplomatisch – gar listig – vorzugehen, um zum erwünschten Ergebnis zu kommen.
Unsere Mutter war auch mit knapp Vierzig und nach sieben Geburten noch eine verdammt adrette Brünette mit dichten Naturlocken, verträumten dunklen Augen und einem schön geschwungenen Mund. Sie achtete stets auf einen dynamischen Gang und legte in der Öffentlichkeit Wert auf einen schmissigen Auftritt. Konnte es genießen, wenn ihr sonnengebräunte Straßenarbeiter sehnsüchtig nachpfiffen.
Sowas vertraute sie mir ganz gern an – stets unter dem Siegel der Verschwiegenheit, aber nie ohne eine gewisse Begeisterung. Heute, mein ich, dürfe ich dergleichen kleine Geständnisse bedenkenlos ausplauschen, ruht sie doch längst dort, wo jedes Geheimnis belanglos wird. Mutti war also nicht eben uneitel und so entschied ich, bei ihrer schwächsten Flanke anzugreifen. Wer konnte schließlich meinen Wunsch, was herzumachen besser verstehen, als ihr kokettes Herz? Auf diesem Weg kam ich denn auch überraschend geschmeidig zum angestrebten Wechsel zu Rogers Figaro und fürderhin zeitgemäßeren Haarschnitten.
Neuerdings konzentrierte ich mich auch auf den Schulweg und versuchte nicht zu allzu sehr zu träumen, weil ich keinesfalls zu spät kommen wollte. So hatte ich es noch in der zweiten Klasse zuwege gebracht, mich auf dem Schulweg einige Male hoffnungslos zu verlaufen, weil ich geistig in meinen eigenen Sphären unterwegs war. Noch heute beschweren sich alle möglichen Leute, ich würde sie in der Stadt geflissentlich übersehen. Unterstellen mir Arroganz. Dabei steckt hinter diesem vermeintlichen Dünkel nichts weniger, als das Erfordernis einer steten Präsenz in meinem Kopfkino.
Für Christiane war ich nun zum Äußersten bereit. Betrat erstmalig seit unserer Flucht in den Westen wieder festen Boden. Damals war ich innerhalb weniger Tage vom Himmel in die Hölle gefallen. Schon mit Vier oder Fünf hatte ich das Kleinstädtchen im thüringischen Eichsfeld zu meinem Revier gemacht. Hatte mein Leben dort astrein eingerichtet. Wusste, dass ich bei Stahlmecke jederzeit ein „Eis ohne Geld“ bekam, wenn ich nur entsprechend freundlich fragte. Im „treuherzig Gucken“ war ich schon damals ziemlich weit vorne. Schnorrte Bonbons im HO, Pfefferminzbruch bei „Onkel“ Riepert und Schokolade bei der Verwandtschaft. Wurde nie gierig, schaute also nur alle paar Tage angelegentlich vorbei, wie man etwa bei Freunden zum Kaffee reinschneit, weil man zufällig gerade in der Gegend ist. Auch das hatte ich ziemlich gut drauf. Ich durfte bei Vati in der Fahrschule sitzen, wenn er Theorie lehrte. Spielte in der letzten Bank selbstvergessen mit jenen kleinen Autos, die gewöhnlich dazu dienten, Verkehrssituationen an der Tafel nachzustellen.
Stand mir die Füße bei jedem Wetter an einer zentralen Kreuzung platt, weil ich gelernt hatte, dass er dort unweigerlich vorbeimusste. Winkte ihm bei jeder Vorbeifahrt im Fahrschulwagen sehnsüchtig zu. Gegen solche Unerschütterlichkeit konnte sein weiches Herz nur verlieren. Mit meinen dicken Brillengläsern werde ich, insbesondere an kalten Tagen, wohl ein ziemlich herzbewegendes Bild abgegeben haben.
Wenn er mich zum fünften Mal passiert hatte, ließ er den Fahrschüler beim sechsten Umlauf anhalten Er stieg aus, beugte seine knappen Einsneunzig seufzend über mich und strich mir kopfschüttelnd durch das Haar. Setzte mich wortlos auf den Rücksitz. Ich gewann immer, weil ich unbedingt Autofahren wollte. Vati machte nie viele Worte, aber er verstand.
Ich fühlte mich denkbar privilegiert, die Gegend zwischen Heimenstein und Petristraße war mein Revier. Jeder kannte den ziemlich verpeilten kleinen Jungen mit der stets schiefen Brille, man gab auf mich acht und meine Geschäfte hätten nicht besser laufen können. Bis zu diesem verwünschten Juni 1961. Wir Kinder freuten uns auf einen schönen Urlaub, aber es wurde eine Reise ohne Wiederkehr. Sicher, unsere Eltern wollten Zukunft, aber die Gründe für die Flucht konnten für einen ziemlich wunschlos glücklichen Fünfjährigen gar nicht nachvollziehbar sein.
Ich bekam schreckliches Heimweh nach dem Verlorenen, ängstigte mich schon bein Zubettgehen vor dem neuen Tag und hoffte bei jedem Erwachen noch lange, die Reise in die Fremde möge genauso plötzlich zu Ende sein, wie sie begonnen hatte. Begann wieder bettzunässen. Die Nachbarskinder schlossen mich keineswegs aus, auch fand sich schon im Kindergarten Uwe, ein bester Freund, wie sich beste Freundschaften unter Kindern gern aus den geringsten Gelegenheiten ergeben und wieder in die Brüche gehen. Uwe war das, was Erwachsene einen Sonnenschein nennen, unbekümmert, kameradschaftlich, sportlich und stets Mittelpunkt. Ich weiß nicht, was ihn an einem Trauerkloß interessierte. Bei mir hatte sich eine innere Einsamkeit eingenistet und so konnte ich seinen Frohsinn nicht immer ertragen. Viele fanden mich wohl nicht allein deswegen schräg, weil ich ihren Dialekt nicht sprach. Es lag nicht nur an ihnen. Ich war in den Grundfesten erschüttert.
Erst Christiane veränderte alles. Zufälligste Berührung jagten mir ungekannt wohlige Schauer über den Rücken. Von ihrer Nähe konnte ich nicht genug bekommen. Ich begann, Geschenke zu machen. Kaufte Brausestangen zu zwei Pfennig das Stück. Die wurden seinerzeit einzeln verkauft und im Schreibwarenladen in kleine Tütchen aus Knisterpapier verpackt. So überreichte ich sie feierlich meiner Freundin. Log dreist und bar jeder Logik, ich äße die gar nicht so gerne, damit sie nur kein schlechtes Gewissen bekäme.
Manchmal schafften es nur deren drei oder vier ins Klassenzimmer, weil ich in Wahrheit nachgerade süchtig nach dem süßsauren Prickeln auf der Zunge war. Meist jedoch opferte ich jede einzelne, die der Groschen Taschengeld hergab, wog ein einziges Lächeln doch leicht tausend verschenkte Brausestangen auf.
to be continued