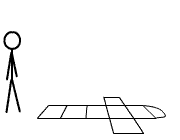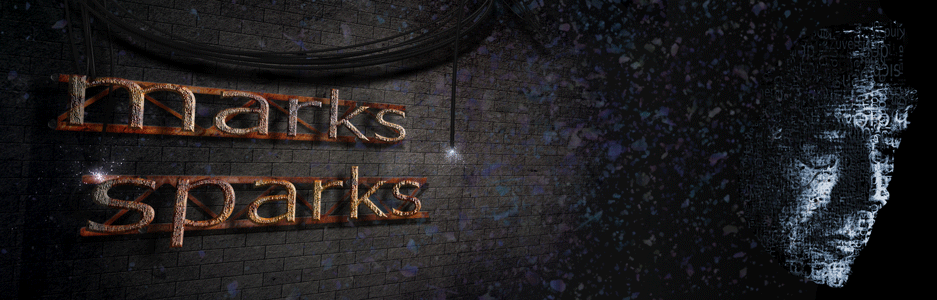Als ich Kind war, musste ich meine Vorstellungen von fernen Ländern durch Annahmen oder Erfahrungen Erwachsener bestätigen lassen. Jener Erwachsenen jedenfalls, denen ein aufgeweckter Junge in einer Erwachsenenwelt mindestens Beachtung wert war. Dankbar kaufte ich Schwärmereien so unkritisch wie Vorurteile, weil das lange alles war, woran ich mich halten konnte. Auf diese Weise vermochte sich manche Absurdität nachhaltig zwischen meine Lauscher zu schleichen. Heutzutage stolpern substanzlose Behauptungen häufig über die kurzen Beine, weil sie bereits von einem geübten Zehnjährigen mit wenigen Mausklicks als schieres Palaver entlarvt werden können. Zudem hat es ungleich mehr Weitgereiste als damals, die es schon aus eigener Anschauung besser wissen.
Es lässt sich denken, wie unbändig ich mich auf den ersten Familienurlaub im Ausland freute. Unser Vater hatte 1940 im Rahmen seiner Ausbildung bei den Gebirgsjägern mit ein paar Kameraden den Watzmann bestiegen. Dieses Erlebnis muss ihn besonders nachhaltig beeindruckt haben. Was ich der Tatsache entnehme, dass er davon stolzer erzählte, als von anderen Erinnerungen. Jedenfalls zog er die Alpen der Ostsee vor und so überquerte ich meine erste Grenze schließlich aufgeregt mit acht oder neun.
An klaren Tagen bot sich vom Küchenfenster unserer Ferienwohnung der unverstellte Blick auf eine beeindruckende Pyramide. Deren vergletscherte Nordflanke die Augustsonne grellweiß reflektierte. Der etwa gleichaltrige Sohn der Vermieterin berichtete nicht ohne Heimatstolz, dass es sich bei der Wildspitze immerhin um den zweithöchsten Österreicher handelte, was mich gleichermaßen faszinierte und frustrierte. Wie oft ich mir als Kind gewünscht habe, fliegen zu können. Hätte ich zu fliegen vermocht, wäre ich sogleich auf den Gipfel geflogen. Aber ich konnte nicht fliegen. Dem Schicksal hatte nun einmal gefallen, einen linkischen und arg kurzsichtigen Knaben aus mir zu machen und keinen Wanderfalken. Anzunehmen, dass bereits der beschleunigte Start zu einem Desaster geführt hätte. Stolperte ich doch bereits beim Milchholen so unbegreiflich täppisch über die eigenen Füße, dass ich mit bestürzender Regelmäßigkeit halbleere Kannen und aufgeschürfte Knie nach Hause brachte. So schnürte ich unentschlossen durch das kleine Dorf und tat, was ich besser konnte. Träumte mich an jenen schneebedeckten Sehnsuchtsort und haderte gleichzeitig mit meinem Geschick, dass mir die Welt nicht gleich vom allerhöchsten Gipfel zu Füßen läge.
Nach den Ferien verhedderte ich mich prompt in den Fallstricken meiner Fantasie. Dichtete die Wildspitze zum höchsten Berg der Welt um – und mich vom kleinen Traumtänzer zum großen Helden der Berge. Das hätte womöglich sogar gut gehen können, wäre nicht Bernd, der Sohn des Apothekers, auf die unselige Idee gekommen, meine naiven Luftschlösser auf solide Fundamente hin abzuklopfen. Dazu brauchte er sich lediglich das Lexikon seiner Eltern vorzunehmen, um zu entlarven, was leicht zu entlarven war.
Seine demütigende Lektion lehrte mich einiges. Ob du als Held oder als Depp in die Geschichte eingehst, entzieht sich nur allzu leicht deinem eigenen Zutun. Zweitens: Eine solide Allgemeinbildung und sinnvolle Fertigkeiten bilden eine wesentlich stabilere Basis für die eigene Reputation als substanzloses Maulheldentum. Drittens: Wenn du gleichwohl unbedingt auf dicke Hose machen musst, sichere wenigstens die Fakten so ab, dass man dir nicht leicht auf die Schliche kommt und viertens: Österreich ist noch lange nicht der Tellerrand. Auch wenn der Wildspitze lediglich läppische dreißig Höhenmeter im Vergleich zum Großglockner fehlen, so trennen ihn von der Gipfelhöhe eines Everest oder K2 doch ein paar Kilometer. Zunächst schmiedete ich finstere Pläne, Bernd nach der Schule abzupassen und für meine Bloßstellung eine handfeste Lektion zu erteilen. Beschloss nach reiflicher Überlegung, künftig lieber mich selbst unangreifbarer zu machen. Auch das sicher eine der vernünftigeren Entscheidungen in meinem Leben.
Jedenfalls achtete ich fortan die Regalreihen mit Kinder- und Jugendliteratur in der Stadtbücherei gering. Machte mich stattdessen ambitioniert über Bildbände her. Die meist schon ihrer Opulenz wegen deutlich mehr Ehrfurcht geboten, als jedes Kinderbuch. Gewaltige Wälzer mitunter, In denen Fotografen ihre Sicht auf die Welt zu manifestieren suchen. Anfänglich hielt ich auch die subjektive Sichtweise dieser Abbildungen für verbindlich. Dazu muss man wissen, dass die meisten Nachkriegsfotografen einer schönfärberischen Ästhetik noch unbedingten Vorrang vor Authentizität gaben. Erfreulicherweise findet heutzutage auch die Vergänglichkeit ihren Weg in beeindruckende Bildbände. Die gewisslich nicht weniger ergreifend ist, als das vermeintlich Ewige.
Zu meiner Freude fand sich an Weihnachten auch der gewünschte Leuchtglobus unterm Baum. Der mir, obgleich wenig größer als ein Fußball, die Ausmaße der Welt viel vorstellbarer machte. Während sich die meisten meiner Altersgenossen ganze Nachmittage im Dribbeln und Toreschießen zu perfektionieren suchten, vertiefte ich mich in Almanache. Vermochte darin viel mehr zu sehen, als nüchterne Statistiken oder Eckdaten über Länder, Flüsse, Millionenstädte und Berge. Verfügte über reichlich Fantasie, all das mit Leben zu füllen. Begann zu ahnen, dass Wissen einer der Schlüssel zu selbstbestimmtem Erwachsensein ist. Also lernte ich begierig, wie hoch, wie lang, wie ausufernd oder bevölkert ebenjene Flüsse, Städte und Berge waren. Wer sie wann entdeckt, gegründet, oder bezwungen hatte. Ich muss gestehen, noch heute ein kindisches Faible für Superlative zu haben. Zwangsläufig muss jede Entdeckung oder Erstbesteigung einzigartig bleiben. Was meine Bewunderung für Entdecker und Erstbezwinger nur steigerte. Erst Sir Edmunds Großtat wegen begann ich mich zunächst für dessen eigene Geschichte, und dann für seine Heimat zu begeistern. Dass sein Begleiter und Sherpa Tenzing für die gleiche Leistung niemals zum Ritter geschlagen wurde, irritierte mich erst sehr viel später. Als Knabe konsumierte ich noch unkritisch, was ich greifen konnte. Ballte vorläufig unstrukturiertes Wissen an.
Als Nord- und Südinsel Neuseelands abgeweidet waren, nahm ich mir Australien vor. Besorgte mir Bildbände über jenen Kontinent, der auf der Weltkugel ziemlich gegenüber liegt. Weil niemand Löcher in seinem Globus braucht und auch der längste Kochlöffelstiel sowieso zu kurz als Mittelachse gewesen wäre, ließ sich das nur über den Daumen bestimmen. Elegantere Lösungen zur genaueren Bestimmung des Antipoden waren mir damals noch unbekannt. So wähnte ich in unter meinen Sohlen lange Tasmanien, tausende Kilometer weg und weit über den Erdmittelpunkt und – das vor allem – über die Hölle hinaus. Jedenfalls, solange diese als klerikale Drohkulisse noch Wirkung tat. Womöglich brachte ich der tasmanischen Teufel wegen einiges durcheinander. Bei einem schwärmerischen Naturell geht schließlich einiges. In meinem Tasmanien sieht es ungefähr noch immer so aus, wie ich es mir als Grundschüler ausgemalt habe. Hingegen schreckt mich ewige Verdammnis heute ebenso wenig, wie ich ernstlich auf eine himmlische Belohnung für irdisches Bravsein spekulieren könnte.
Vor gut fünfundzwanzig Jahren hatte ich mich, im Rahmen einer ausgedehnten Asienreise, tatsächlich einmal auf den Weg nach Tasmanien gemacht. Vielleicht, um mich Vorgefasstem zu versichern oder verfestigte Vorurteile zu evaluieren. Rund um den Globus, statt mittendurch. Da von Singapore keine Direktflüge nach Hobart abheben, legte ich einen Zwischenstopp in Brisbane ein. Wo ich sehr kurzfristig meine Reisepläne umwarf und nach Neuseeland umbuchte. Anlass dafür war eine Begebenheit welche genügte, mir den fünften Kontinent für alle Zeiten zu verleiden. Ich war in die Stadt gegangen, um mich ein wenig umzusehen, ein paar Besorgungen zu machen – weshalb auch immer. Jedenfalls entdeckte ich in der Auslage eines Waffengeschäfts ein ausgesprochen langläufiges Gewehr. Das Schild unter der Flinte war einigermaßen ausgebleicht und sicher nicht erst seit dem vorigen Tag im Fenster: „Perfect for Roo and Abo hunt“. Offenbar hatte noch kein Mensch Anstoß an diesem armseligen Späßchen genommen. Zumindest nicht derart nachdrücklich, dass der Witzbold die Werbung aus seinem Fenster entfernt hätte. Ob diese Aussage neben ethischen Normen auch justiziable verletzte, weiß ich nicht. Womöglich habe ich nur eine sprachliche Doppeldeutigkeit nicht verstanden. Was aber hätte eine solche an der kranken Botschaft geändert? Zu meinem Glück war der Laden an diesem Tag geschlossen. Wer kann wissen, was sich aus einer Schreierei mit einem menschenverachtenden Waffennarren entwickelt. Am nächsten Tag stehst du womöglich selbst in der Zeitung und fliegst im Bauch einer Frachtmaschine nach Hause.
Vor zweieinhalb Jahrzehnten bin ich, Aussies betreffend, affektiv vor einem Schießprügel in einem Brisbaner Schaufenster hängengeblieben. Nicht wenige Reisende haben seither versucht, dieses Bild mit guten Worten und eigenen Anekdoten geradezurücken. Ist ja nicht so, dass ich all diese Bemühungen und Argumente nicht wertschätzen könnte. Dennoch sträubt sich einfach alles dagegen, unverhohlenen Menschenhass als Ausnahme und Ausrutscher zu relativieren. Der Punkt ist letzlich nicht nur das ekelhafte Plakat, sondern außerdem die Tatsache, dass es offensichtlich, selbst über einen längeren Zeitraum, keinen wirklich störte. Mittlerweile ist mir auch ziemlich schnurz, ob andere meine aufrichtige Animosität gegen ein Volk von Ignoranten in Ordnung finden, oder nicht. Habe ich nicht auch jedes Recht auf Vorurteile?
Und schließlich habe ich vor vielen Jahren in einer Doku über aussterbende Tiere wirkliche tasmanische Teufel gesehen. Auch hier entsprach die Realität keineswegs meinen Erwartungen. Ich muss sogar eingestehen, außerordentlich enttäuscht gewesen zu sein. Dahingehend habe ich das Aufgezwungene mittlerweile wieder erfolgreich verdrängen können und sehe agile kleine Gesellen mit Hörnchen und Bocksfüßchen vor meinem geistigen Auge, sobald, im alltäglichen Umgang selten genug, von tasmanischen Teufeln die Rede ist.
Einen ersten praktischen Bezug erhielt mein Fernweh, als sich in unregelmäßigen Abständen Ansichtskarten meines ältesten Bruders einfanden. Hatte er sich als Schiffsjunge noch auf kleineren Kümos auf Nord- und Ostsee herumgetrieben, wurden aus schwedischen oder irischen Ansichten mit den Jahren und gehobeneren Diensträngen farbenfrohe Abbildungen aus aller Welt. Von Guayaquil zum Beispiel, wo Unmengen Bananen nach Europa oder Nordamerika verschifft werden. Von Los Angeles brachte er mir einen grellbunten Sticker mit. Der, niemals geklebt, erst bei einem meiner letzten Umzüge verloren ging. Wenn Thomas zu Besuch kam, erzählte er bereitwillig viel und doch stets zu wenig. Denn eigentlich wollte ich alles noch viel genauer wissen. Dafür hatte das, was er zu berichten wusste, oft in sich. Noch heute schaue ich erst sehr sorgfältig hin, bevor ich mir ein paar Bananen aus einer Bananenkiste im Supermarkt fische. Derart eindrücklich hallt seine unheimliche Begegnung mit einer handtellergroßen Bananenspinne auf dem Frachter nach. Wobei man heutzutage wahrscheinlicher auf ein verirrtes Päckchen Koks stoßen wird, als auf einen giftigen Achtbeiner. Ich beneidete Thomas, für den es keinen leuchtenden Globus brauchte, um den Indik von Durban her zu befahren. Für mich stand er damit beinahe auf einer Stufe mit Vasco da Gama oder António de Abreu. Seine Reise führte freilich noch weit über die Gewürzinseln hinaus. Bis nach Kobe in einem, für mich noch sehr geheimnisvollen, Japan reiste mein großer Bruder.
Zeit, sich meinem Onkel Karlheinz zu nähern. Ich weiß nicht, ob sein Name mit Bindestrich geschrieben wurde oder zusammen, also in einem Wort. Die Schreibweise seines Namens ist für diese Geschichte aber eher nachrangig. Wesentlich hingegen die Tatsache, dass dieser Onkel ein außerordentlich belesener Mensch war. Ein ausgemachter Feingeist zudem. Seiner Moralität wäre die Zuschreibung „Gentleman“ vielleicht reingegangen, die eigene Bescheidenheit hätte sie vermutlich verlegen gemacht. Der Onkel verstand sich auf zielsichere Geschenke. Vermochte dem Beschenkten stets das Gefühl zu vermitteln, als mache ihm dieser allein mit dessen Annahme eine ungeheure Freude. Lebte völlig selbstverständlich, was er vertrat. Sicherlich nicht aus Koketterie, sondern aus seiner noblen Gesinnung heraus. Meine frühe Begeisterung für Amerika ging ohne jeden Zweifel mit der Bewunderung für diesen Onkel einher.
Zeit für ein Geständnis. Dass nämlich der Titel meiner Geschichte ein bisschen reißerisch ist. Weil besagter Onkel keineswegs aus Amerika stammte, sondern wenige Jahre vor Kriegsausbruch in der Quadratestadt geboren war. Gleichwohl habe ich den Titel sehr bewusst gewählt, weil ich darauf spekuliere, dass sich beinahe jeder einen Onkel in Amerika wünscht. Dachte so bei mir, dass also viele dieser Menschen gerne aus erster Hand erfahren würden, wie einer mit dem Glück umgeht, einen solchen Onkel zu haben. Damit kann ich tatsächlich nicht dienen, weil ich es selber nicht weiß. Indessen hatte mein Onkel durchaus Bezug zu den USA. So ganz ist der Titel nun auch nicht aus der Luft gegriffen. Der Onkel verdiente seine Brötchen als Bibliothekar in der Bücherei der amerikanischen Streitkräfte in Mannheim. Arbeitete also gewissermaßen in einer Filiale der USA. Was meine Übertreibung womöglich in einem etwas günstigeren Licht erscheinen lässt. Die amerikanische Community zählte damals in Mannheim immerhin so viele Seelen, wie die gesamten US-Streitkräfte nebst Angehörigen im heutigen Deutschland zusammen. Wer sich jetzt um seine Erwartungen betrogen fühlt, sollte besser gleich abschalten – respektive weglesen. Und am Ende nicht beleidigt rumjammern, weil ihm das Leben einmal mehr vorenthält, auf was er ein Recht zu haben glaubt.
Außer täglichen zwei Schachteln WY Chester und seinen Büchern beanspruchte der Onkel nichts für sich. Dann und wann einen Cognac vielleicht. Der Onkel, der strenggenommen nicht mal mein richtiger Onkel war. Sondern nur einen Nennonkel aus der erweiterten Verwandtschaft vorstellte. Einen adoptierten Onkel sozusagen. Seine, mittlerweile weitgehend in Vergessenheit geratene, Zigarettenmarke war, trotz ihres amerikanisch anmutenden Namens, ein urdeutsches Kraut. Ich habe diese auch nur deshalb erwähnt, weil der Adoptivonkel die Sorte allein aus dem Grund rauchte, um sich auch nicht ansatzweise dem Verdacht der Steuerhinterziehung auszusetzen. Als qualme er quasi schon aus guter Gelegenheit unverzollt. Was damals sicherlich halb Mannheim völlig bedenkenlos tat.
Mit seiner Mutter und einer langjährigen Untermieterin, die als Tante Mathilde gleichfalls großzügig zur Familie gezählt wurde, bewohnte er ein geräumiges Haus mit ehrwürdigen Möbeln und einem gepflegten Garten. Dieser ließ sich, wie auch der Keller, nur durch eine Garage ohne direkten Zugang zur Fahrbahn betreten. Die Garage diente ausschließlich als Schuppen für Rasenmäher und Gartengerät. Für drei Fahrräder und einen selbstgebauten Fahrradanhänger. Eine solide Werkbank, die seit Jahren der Abholung eines seiner Brüder zuwartete. In dieser Garage roch es den ganzen Sommer über wunderbar nach geschnittenem Gras, nach Kettenöl und Rosenblättern. Im Herbst gesellte sich der Moder von vertrocknetem Laub und abgestandenem Wasser dazu. Als ich einmal im tiefen Winter in den Keller geschickt wurde, um vom selbstgemachten Sirup zu holen, stellte ich überrascht fest, dass Kälte Gerüche gewissermaßen dimmt. Was du wahrscheinlich nur bemerkst, weil du das selbstverständlich gewordene auf einmal vermisst.
Sommers wie winters fuhr der Onkel mit seinem Rad zur Arbeit, das rechte Hosenbein mit einer metallenen Fahrradklammer verlässlich gegen Zerriss und Schmiere gesichert. Er interessierte sich nicht die Bohne für Autos, nicht mal für amerikanische. Was mir unbegreiflich war, denn ich war vernarrt in diese barocken Orgien aus Blech und Chrom. Der Onkel war geradlinig. Zugewandt. Konservativ in einer unaufdringlichen Art. Lebte seine Prinzipien, ohne gegen andere pedantisch zu sein. Prinzipienreiter sind schrecklich anstrengende Menschen. Vom American Way hatte er die Selbstverständlichkeit, die Liberalität, die Lässigkeit für sich entdeckt und seinem Wesen angepasst. Fremd musste seiner vornehmen Geisteshaltung die amerikanische Großspurigkeit bleiben, diese Weltläufigkeit ständig rauszuhängen. Wobei man fairerweise anmerken muss, dass sich wesentliche Teile der amerikanischen Gesellschaft tatsächlich libertärer entwickelt hatten, als die stockkonservative Mehrheit in der Bundesrepublik Mitte der Sechziger. In der der tausendjährige Mief offenbar schwieriger aus den Klamotten zu schütteln war, als gedacht. Woran allerdings auch die 68er ein paar Jahre später nicht wirklich viel änderten. Die ihre Korinthen kein bisschen weniger verkniffen kackten, als ihre Eltern. Deren Piefigkeit trabte lediglich auf höherem Rösslein daher.
Der Onkel ließ ungern von seinen Gewohnheiten. Er mochte sein Zuhause und liebte seine Arbeit. Verließ nur notgedrungen die getakteten Abläufe und machte sich auf einen gebotenen Weg. Etwa zur Frankfurter Buchmesse, oder um einen seiner Brüder zu besuchen. Aus Abenteuerlust hätte er sich nie auf eine Reise begeben. Einzig aus Pflichtbewusstsein und schließlich gehört ein Besuch der Frankfurter Buchmesse zu den Aufgaben eines Bibliothekars. Reiste nach Köln zu Klaus, seinem jüngsten Bruder. Womöglich wollte er sich einfach von Zeit zu Zeit der brüderlichen Zusammengehörigkeit vergewissern. Für ein paar Tage nichts als Bruder sein. Anzunehmen, dass sich Klaus als Intendant, Regisseur und Darsteller einer der unzähligen avantgardistischen Kleinbühnen der späten Sechziger eher brotlos verwirklichte. Er kam stets ein bisschen anämisch daher, wenn er selbst in Mannheim aufschlug. Ließ sich einige Wochen von seiner Mutter rausfüttern und entschwand einigermaßen aufgepolstert wieder rheinabwärts. Durchaus möglich, dass der gute Onkel Karlheinz ihm dann und wann auch finanziell unter die Arme greifen musste.
Häufiger machte er sich zu Tagesfahrten ins näher gelegene Bauland auf, wo Franzhepp als Lehrer einer Einklassenschule eine eher altväterliche Lebensweise pflegte. Aufgepeppt mit vielen bunten Flicken aus durchaus fortschrittlichen Ansichten. Einmal durfte ich den Onkel zur Familie des jüngeren Bruders nach Bödigheim begleiten. Noch heute erinnere ich mich dieses Besuchs als eine Art Zeitreise. Obwohl die beiden Töchter noch klein waren, empfand ich das ganze Drumherum doch beinahe als opaesk. Ein bisschen wie bei meinem eigenen Großvater, der Dorflehrer in Bodenrode gewesen war, Stumpen rauchte und Bienen hielt. Womöglich beginne ich aber auch schon, eigentlich unzusammenhängende Erinnerungen durcheinander zu würfeln.
Onkel Hansjörg, der Älteste schließlich, hatte sich auf der Schwäbischen Alb eingerichtet. Seine erste Frau starb zu früh, was ihn ziemlich aus dem Tritt brachte. Als Handlungsreisender futterte er sich ein paar Jahre ziemlich verzweifelt durch die halbe Republik. Lernte auf diesem Wege und eines guten Tages eine Wirtin kennen, die als erfreulich drall beschrieben wurde. Dem Vernehmen nach verstand sich die Frau zudem vorzüglich auf die raffinierte Zubereitung erlesener Speisen. Diese betörende Kombination ließ Hansjörg endlich in seiner verstörenden Raserei innehalten. Er heiratete gegen seinen ursprünglichen Vorsatz ein zweites Mal und erfand das Homeoffice, als der Begriff noch gar nicht geboren war. Damit er jeden Mittag bei seiner Wirtin und ihren Kochkünsten sein konnte. Eines anderen Tages und wenige Jahre später stand er von einem gemeinsamen Mittagsschlaf auf, presste kurz aufstöhnend die Rechte aufs Herz und fiel tot vor dem Bett um.
Sie waren sehr verschieden voneinander, die vier Brüder, aber gewisslich suchte jeder von ihnen seinen eigenen Traum zu leben, so gut es das Leben eben mit ihm meinte. Was durchaus nicht jeder von sich behaupten kann.
1967. Bei Rassenkrawallen in Detroit kommen siebenundvierzig, meist dunkelhäutige Menschen ums Leben.. Über sechshundert Gebäude werden durch mutwillig verursachte Brände stark beschädigt oder komplett zerstört. Der Gouverneur mobilisiert die Nationalgarde. Trotzdem braucht es fünf Tage, bis „die erwünschte Ordnung wiederhergestellt ist“. Der Pastor Martin Luther King kämpft mit seinen Mitstreitern einen gewaltlosen Kampf gegen die Diskriminierung der Minderheiten. Er sagt: „Wir müssen lernen, entweder als Brüder miteinander zu leben, oder als Narren unterzugehen“. Malcolm X war einen anderen Weg gegangen. Als konvertierter Moslem lehnte er ab, Fairness von einer christlichen weißen Gesellschaft zu erbetteln. Bezeichnete jeden moderaten Bürgerrechtler, der nicht von der christlichen Tradition der weißen Herren lassen wollte, abschätzig als „Hausneger“ oder „Onkel Tom“. Wurde Mai 1965 von Angehörigen seines Ziehvaters und Religionsführers der Nation of Islam über den Haufen geschossen. Mit dem er sich überworfen hatte, weil dieser sich von der eigenen Macht zunehmend hatte korrumpieren lassen. Auch der Boxweltmeister Cassius Clay konvertiert zum Islam und bekommt als Muhammad Ali wegen Wehrdienstverweigerung seinen Titel aberkannt. Er begründet die Weigerung, für sein Land in den Krieg zu ziehen, neben religiösen Gründen unter anderem mit einem Zitat des Bürgerrechtlers Stokey Carmichel: „Kein Vietcong nannte mich jemals Nigger“. Ali stirbt 2016 nach einer langjährigen Parkinsonerkrankung. Nur noch ein trauriger Schatten seiner einstigen Größe, und längst auch von den Weißen vereinnahmt, aber hochgeehrt. Der gute Stokey zieht die richtigen Schlüsse und empfiehlt sich nach Afrika. Bringt seinen Hintern aus der Schusslinie, bevor ihn irgendwer umnieten kann. Er stirbt kurz vor der Jahrtausendwende friedlich in seinem Bett.
Onkel Karlheinz zog mich mit den lebendigsten Schilderungen seines Amerika in den Bann. Einem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, um ein vielgequältes Bild zu bemühen. Der Onkel entwarf Biographien von reich gewordenen Tagelöhnern, die es allein mit Fleiß und Fortune zu einer eigenen Ranch gebracht hatten. Von Arbeitern, die mit nichts aus Europa gekommen waren und ohne Weiteres zu Fabrikbesitzern werden konnten. Die in keinem anderen Land der Welt derart einfach ihr Glück gemacht hätten. Als ich nach den Indianern fragte, erzählte er von gewissenlosen Büffeljägern, die mit der beinahe vollständigen Ausrottung die Indianer an den Rand von Hungersnöten gebracht hatten. Von einer vorausschauenden Politik großer Präsidenten, die den Ureinwohnern in ihren Reservaten Schutz, Zuflucht und ein Auskommen bot.
Er begeisterte sich für die Metropolen, in denen das Leben für die Bewohner angenehm und bequem war, ebenso, wie für das hypnotische weizengelbe Wogen im Corn Belt. Von gewaltigen Naturwundern in den Nationalparks, zu noch gewaltigeren Gipfeln in den Rockies oder Alaska. Wir wanderten in den Badlands, paddelten in Mangrovensümpfen und der Onkel gab acht, dass mich kein Alligator aus dem Boot zog. Überflogen in einer vierpropellrigen Super Conny die Canyons in Arizona und Utah. Zum Dessert servierten traumschöne junge Frauen Ananastörtchen. Von beidem hatte ich durchaus klare Vorstellungen. Weil ich zwischen Hungerharke und Frankfurt schönen Stewardessen begegnet war. Die mich freigiebig mit Ananastörtchen bewirtet hatten, deren prickelnd süße Säure nie mehr vergisst, wer sie einmal kosten durfte. Wer Nachschlag begehrte, brauchte nur den Arm zu heben. Schon schwebte die Stewardess heran, zart und zerbrechlich wie Audrey Hepburn. Lächelte ein glückliches Lächeln. Lächelte wie eine, die ein erfülltes Leben lebt – und kategorisch nichts als Erfüllung vom Leben erwartet. Eines Tages würde sie einen Millionär – oder wenigstens einen Flugkapitän – heiraten und fortan nur noch einem Prinzen die Wünsche von den Augen ablesen. Würde eines glücklichen Prinzen Prinzessin sein und vor Glück beinahe platzen. Schließlich war sie für diese Illusion Stewardess geworden. Damals. Heutzutage verkaufen Flugbegleiterinnen Lotterielose, Dosenbier und Schokoriegel. Müssen sich dreimal pro Flug von degenerierten Bonobos dumm von der Seite anquatschen lassen und wissen längst zu viel vom Leben, um noch an Prinzessinenträume zu glauben.
Der Onkel und ich bereisten die Urwälder im Nordwesten wie die Wüsten im Südwesten, wo Klapperschlangen und Skorpione zuhause sind. Fuhren mit einem Greyhound von Boston nach Bar Harbor und führten uns, Oberkante Unterlippe, Blaubeerpancakes mit Ahornsirup zu. Die Hummer, die in unzähligen Hummerbuden an den Durchfahrtsstraßen in Fässern gekocht wurden, hätte ich allerdings nicht mal geschenkt gewollt. Weil der Onkel meinte, man könne die amen Viecher schreien hören, wenn sie lebend ins siedende Wasser geworfen würden.
Wir ließen den Indian Summer hinter uns und fuhren mit der Eisenbahn. Ich erinnere mich der sofabreiten Pullmannsitze, die zum Träumen einluden. Der unbezahlbaren Aussicht durch beinahe rahmenlose Panoramafenster, sobald man aus einem Wachtraum aufschreckte. Nach den rauchenden Schloten in Indiana und Illinois entlang der großen Seen hatten wir bald Milwaukee und eine Weile später auch Minneapolis hinter uns gelassen. Staunten über die endlosen Reihen von hübsch eingezäunten Vorgärten, in denen die Häuser von Arbeitern und kleinen Angestellten standen, wie mein Onkel wusste. Denn in seinem Amerika war alles möglich.
Wir durchquerten die Great Plains North Dakotas, in denen sich die Populationen der Büffel ganz allmählich wieder erholten. Wo es keine Einfriedungen brauchte, weil die meisten menschlichen Behausungen derart weit auseinander lagen, dass man selbst den direkten Nachbarn höchstens zu Gesicht bekam, wenn man sich ausdrücklich verabredete. Wenn man einmal eine halbe Stunde verdöste, verpasste man nichts. Gleichförmig erstreckt sich diese Landschaft von Horizont zu Horizont. Und auch wenn dieser erreicht ist, ändert sich das Bild noch lange nicht. Die Prärie ist eine Landschaft ohne Anfang und Ende. Ein uferloses Meer. Ich erinnere jenes sanfte Schaukeln, wenn der Zug über eine Weiche glitt. Sehe die liebevoll polierten Uniformknöpfe des Schaffners vor mir. Den gestärkten Hemdkragen. Die ausgesuchte Krawattennadel. Die massive Uhrkette. Seine glänzenden Schuhe. Die makellos weißen Handschuhe. Der kleine schwarze Schaffner, der nur deshalb Schaffner geworden war, weil er fest daran glauben wollte, dass ihm eine schnieke Uniform zu Sozialprestige und Respekt verhülfe. Jenen Respekt, den man ihm, seit er sich erinnern konnte, viel zu oft verwehrt hatte. Der seine Position mit jener Würde und Hingabe ausfüllte, wie es nur Menschen vermögen, die lieben, wozu sie sich bestimmt sehen. Deren Beruf über die Jahre zum Lebensinhalt geworden ist. Schließlich erreichten wir eines Morgens unser Ziel, die schneekalten Wälder Montanas.
Meist zerrannen über diesen Geschichten Stunden zu Minuten. Erst, wenn die Farben des großen Zimmers zu verblassen begannen, wenn Licht und Schatten zu einem gestaltlosen Grau verschwammen, wurde es höchste Zeit, in mein eigenes Leben zurückzukehren. Nicht selten ging ich wie im Traum durch das abendliche Viertel nach Hause. Schien nur durch ein Versehen in dieses Leben hineingeboren zu sein und nicht in eines jener fernen, die mir zunehmend so viel begehrenswerter erschienen. Ich wünschte mich in eines dieser Farmhäuser mit einem Windrad hinter der Scheune und einem knarrenden Schaukelstuhl auf der Holzveranda. Hinter das Fenster eines sturmumtosten Hauses über einer kreidigen Steilküste. Selbst jene Arbeiterhäuschen in den Gärten mit den weißen Lattenzäunen schienen mir tausendmal erstrebenswerter als das, was ich hatte. Manchmal vermochte ich tagelang nicht aus einer Traumreise auszusteigen. Der Onkel hatte mit seinem beinahe missionarischen Eifer längst jene Begehrlichkeit geweckt, der Amerika zum Sehnsuchtsort meiner Kindheit werden ließ.
1968. Martin Luther King ist tot. Ermordet in Memphis von einem weißen Rassisten. Einem Narren, der nur hassen gelernt hatte. In Vietnam krepieren weiterhin auch Schwarze, für die die Armee eine der wenigen Möglichkeiten eines bescheidenen sozialen Aufstiegs bietet. Die GIs sterben nicht für ihr Vaterland, sondern um ein Vasallenregime in Südvietnam zu halten. Die jungen Männer verteidigen keineswegs die Heimaterde. Stützen nichts als einen weißen Kolonialismus, der den unbehinderten Zugriff auf die Ressourcen der ganzen Welt unbeirrt als sein gottgegebenes Recht begreift.
Vietnamesische Zivilisten erwischt es ungleich häufiger als Vietcong. Bauern auf ihren Feldern, Frauen, Kinder und alte Menschen – kurz, was sich zum Schutz vor den anrollenden Wellen der B 52 nicht in irgendwelchen unterirdischen Tunneln und Bunkern verkriechen kann. Sie sind dem Bombenregen schutzlos ausgesetzt. Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman und General Dynamics verdienen sich dumm und dämlich. Zehntausende Kleinaktionäre reiben sich die Hände. Sie können die Kinder aufs College schicken und ihre Einfamilienhäuser mit Doppelgarage und Pool zügig abbezahlen. Häuser, die auf diesen moralischen Morast gebaut sind. So what? So funktioniert Kapitalismus nun mal. Warum sollen kleine Leute nicht auch was von imperialen Raubzügen haben?
Der Onkel konnte sich für die Hippiebewegung begeistern. Erzählte von der Aufbruchstimmung in San Francisco. Von einem Musikfestival im Nordosten, wie es die Welt noch nicht gesehen hatte. Das gewaltlos auf den Wiesen eines Farmers in Woodstock über die Bühne ging. Wo Ethnien schrankenlos miteinander glücklich sein konnten. Auch das gehörte zu jener Welt, die ihn begeisterte. Für ihn waren all diese jungen Menschen Ausdruck einer sich zunehmend befreienden Gesellschaft. Und eine Bestätigung seiner These von einem freieren Amerika.
Ob er die Horden hirnloser Rednecks nicht wahrnehmen wollte? Die sich in hässlicher Regelmäßigkeit zu Mobs zusammenrotteten. Sich ihr Freizeitvergnügen, nach eigenem Rechtsverständnis einen Schwarzen aufzuknüpfen oder totzuschlagen, weder durch Gesetze noch Moral vermiesen ließen. Und sich dafür in den seltensten Fällen zu verantworten hatten. Weder vor einem weltlichen Richter noch von der Kanzel herunter. Wo sie allenfalls geringe Strafen oder Tadel zu erwarten hatten, wenn sie es übertrieben. Kraft Tradition und Ideologie zur Verächtlichkeit nachgerade ermuntert wurden. Wie willst du ein Bewusstsein für Unrecht entwickeln, wenn Rassismus gesellschaftlich nicht als verwerflich, sondern als normativ und gottgefällig begriffen wird? Bemerkte der Onkel die, sich zunehmend radikalisierenden, Underdogs in den schwarzen Vorstädten der Industriezentren an den großen Seen nicht? Die die Schnauze von den Herrenmenschenmätzchen so gestrichen voll hatten, dass sie bald nicht nur nach Umsturz, sondern auch nach einer eigenen Nation riefen. Die in ihrer blinden Ohnmacht sogar häufig ihre eigenen Viertel anzündeten. Ich weiß es nicht. Negative Untertöne über das Land seiner Träume erinnere ich allenfalls aus ein paar vage gehaltenen Andeutungen.
Der Onkel war gebildet, informiert und ganz sicher alles andere, als unkritisch. Las regelmäßig den „Spiegel“, informierte sich aus der „Zeit“. Hatte andererseits den „Readers Digest“ abonniert, der, vorsichtig formuliert, ein recht einseitiges Weltbild verbreitete. Ich erinnere mich mit Scham, dass ich einmal das Credo eines, an sich unsäglichen, Artikels pro Sojaanbau in einem Referat für die Schule ziemlich naiv wiederkäute. Mein erstes Machwerk hieß, wenn ich mich recht erinnere: „Auch sechs Milliarden wollen essen“, und war ein völlig unreflektiertes Loblied auf die amerikanische Agrarindustrie. Weiß dafür auch nur eine Entschuldigung: Ich war jung und brauchte die Note. Bin mir gleichwohl einigermaßen gewiss, dass der Onkel hinter die Kulissen sah. Womöglich trug er der Tatsache Rechnung, dass ich als Kind noch dünnhäutiger war als heute. Zu lebensfremd für das widersprüchliche Amerika jedenfalls. Vielleicht glaubte er auch, seinem Arbeitgeber Loyalität zu schulden. Wie dem auch sei. Es ist zu spät, ihn zu fragen.
Luftwaffengeneral Curtis LeMay hatte seiner Nation schon in den frühen Sechzigern unmissverständlich versprochen, das Land am Mekong „in die Steinzeit zurückzubomben“. Zusätzlich zu den Flächenbombardements werden im Verlauf der „Operation Ranch Hand“ zwischen 1962 und 1971 achtzig Millionen Liter Entlaubungsmittel über vietnamesischen Plantagen, Feldern und Wäldern versprüht. Vorgeblich mit dem Ziel, Feindbewegungen besser aus der Luft beobachten zu können. Als sei diese Idee nicht schon für sich zynisch genug, verunreinigt man diese Herbizide in den Laboren von Chemical Dow und Monsanto mit Dioxinen. Für eine effektive Langzeitwirkung auf den vietnamesischen Genpool. Das Mittel wird zum Verkaufsschlager für beide Konzerne und einer breiteren Öffentlichkeit als Agent Orange bekannt. Den Rest erledigen Brandbomben, die auf die vertrockneten Pflanzenreste abgeworfen werden, um Feuerstürme auszulösen. Diese Operation schmückt sich mit dem höhnischen Namen: „Sherwood Forest“.
1969. Ich wiederhole die Quinta. Mathe „ungenügend“. Physik „mangelhaft“. Was auch durch das „sehr gut“ in Geographie und die Zwei in Deutsch nicht zu kompensieren war. Gegen eine Sechs in einem Hauptfach musst du eine Eins in einem anderen aufbieten. Zwei Vieren oder eine Drei und eine Fünf reichen hingegen. Was Mathematik für mich damals nicht logischer machte. Überhaupt: Was anderen reine Logik schien, stellte für mich eine abstrakte Welt ohne erkennbaren Nutzen dar. Heute weiß ich es besser. Man sollte Naturwissenschaften keineswegs unterschätzen. Manch einer, der es wissen sollte, behauptet gar, mit Mathematik und Physik ließe sich das ganze Universum beweisen. Das will ich gerne glauben. Allerdings ist das nichts für mich. Nicht mehr. Längst nicht mehr. Ich möchte nur noch äußerst selten etwas beweisen. Prüfe nur ganz gern, an sich irrelevante, Informationen nach. Eher so ein Steckenpferd, weil ich heute über alle Zeit verfüge und von Haus aus wissbegierig bin. Ich will das mal an einem Beispiel erläutern.
Wenn ich also beispielsweise irgendwo lese, die Golden Gate Brücke sei 2737 Meter lang, reizt mich die Idee, nach Fog City zu reisen und nachzumessen. Nur so für mich. Es geht keineswegs darum, zu beweisen, dass sich die Welt irrt. Ich kann diese Kontrolle mit einer schönen Reise verbinden, Cable Car fahren oder einen Drachen am Strand steigen lassen. Am Hafen ein kleines Lokal finden, vor dem auf einer ungelenk bekritzelten Schiefertafel fangfrisches Seafood angepriesen wird. Alles außer Hummer. Ob auch andere Krustentiere beim Brühen schreien, will ich gar nicht wissen. Müsste mich vor allem nicht dafür rechtfertigen, wie in aller Welt ich es anstelle, schon wieder Urlaub machen zu können. Die Frage stellte sich gar nicht, weil ich ja gewissermaßen dienstlich unterwegs wäre. Könnte mich leicht damit bescheiden, festzustellen, dass die Angaben in den Almanachen bezüglich der roten Brücke auf den Millimeter stimmen. Ist doch super, Schwamm über die ganze Geschichte. Schließlich ist das eine Wette, bei der man nichts verlieren kann. Immerhin bin ich einen halben Tag Kabelbahn gefahren und habe erstklassig diniert.
Aber selbst, wenn meine Berechnungen zum Ergebnis kämen, Golden Gate sei einen Dezimeter kürzer, oder einundzwanzigkommazwo Zentimeter länger als in den Büchern, würde ich deswegen nicht eine Welle machen. Recht behalten zu wollen, interessiert mich schon lange nicht mehr. Besserwisserei vermag das Dasein kein bisschen zu bereichern. Weil sie jedes Beisammensein früher oder später unweigerlich destruiert. Weil Rigorismus untrüglich auf Unsicherheit hinweist. Auch das scheinbar noch so Gewisse ist zwangsläufig stets mit einem Rest von Vermutungen durchsetzt. Dieselbe Brücke ist im Winter kürzer und im Sommer länger. Was sich durch physikalische Gesetze ziemlich zweifelsfrei beweisen lässt. Schon während du deine Vermessung durchführst, können sich womöglich alle möglichen Umstände ändern.
Belegloses Beharren auf der eigenen Position bedeutet immer auch Realitätsverweigerung. Insbesondere dann, wenn du glaubst, einen Standpunkt verteidigen zu müssen, von dem du weißt, dass ihn andere mit schlüssigeren Argumenten bereits zehnmal zerpflückt haben. An dem du trotzdem verzweifelt festhältst, weil du aus irgendwelchen Gründen glaubst, deine gesamte Integrität stehe und falle mit dieser einen Sache. Häufig meinen Diskutanten sogar dasselbe, betrachten das Problem naturgemäß nur aus ihrer subjektiven Position. Am Ende wäre es auch für deine eigene Welt völlig einerlei, wer objektiv vielleicht ein Quäntchen näher an einer absoluten Wahrheit läge. Auch das lässt sich lernen, wenngleich äußerst mühsam.
Ich habe mir hingegen ausgemalt, dass es womöglich einfach ein gutes Gefühl wäre, einmal etwas zu wissen, was sonst garantiert kein Mensch auf der ganzen Welt weiß. Und sei es die ziemlich exakte Länge einer Brücke, die die meisten Menschen immerhin von Bildern kennen. Das Ergebnis könnte ich beispielsweise pathetisch in einen letzten Brief an meine Tochter verpacken, wenn ich merke, dass es dem Ende zugeht. Damit diese einzigartige Information auch nach meinem Ableben nicht verloren ginge. Dann könnte sie entscheiden, ob sie dieses Wissen für sich behielte. Ob sie es mit wenigen Vertrauten teilen würde oder triumphierend in die Welt hinausposaunte. Je nachdem, wie viel sie bis dahin schon vom Leben begriffen hätte.
Aber dazu wird es kaum kommen. Denn als ich diese Idee einmal mit einem Freund besprechen wollte, begann dieser sogleich ungefragt davon zu berichten, dass sich just von dieser Brücke jedes Jahr ungefähr fünfundzwanzig Menschen das Leben nehmen. In manchen Jahren ein paar mehr, in guten weniger. Sie springen etwa siebzig Meter tief in die eiskalte Bay. Zerplatzen, je nach Aufprallwinkel, entweder gleich beim Auftreffen auf der Wasseroberfläche wie reifer Pfirsich auf Trottoir. Oder treiben mehr oder weniger verletzt ab und erfrieren oder ertrinken. Hin und wieder sind die Boote der Küstenwache rechtzeitig genug, um noch lebendige Reste aufzufischen.
Einen Selbstmörder nach der Rationalität seiner Entscheidung zu fragen, ist ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen. Ein Sprung von der Brücke ist vermutlich in den allermeisten Fällen eine höchst affektive Geschichte. Die meisten scheinen jedenfalls vor dem Absprung kaum rumzueiern, was sich durch stationäre Überwachungskameras nachvollziehen lässt. Sind kurzentschlossen und fackeln nicht lange, bevor sie über das Geländer klettern und sich abstoßen. Besinnen sich wahrscheinlich erst unterwegs und bis zum Aufklatschen noch dreimal, dass sie gerade was ziemlich Endgültiges angefangen haben. Anzunehmen, dass viele in ihrem jähen Bewusstsein über dessen Tragweite vermutlich sogar vergessen, an jene Kurzfassung zu denken, die am Abspann ihres Lebens eigentlich vor dem inneren Auge ablaufen müsste. Auch das wusste mein Freund: Die wenigen Überlebenden erzählten beinahe ausnahmslos, dass sie ihre Entscheidung direkt nach dem Absprung bereuten. Von einem Film berichtete hingegen kaum einer.
Es lässt sich leicht denken, dass ich ziemlich erschlagen von dieser ungeheuerlichen Informationsflut war. Nahm auch, angesichts fundamental veränderter Voraussetzungen sogleich Abstand von meiner, an sich formidablen, Idee. Schließlich kenne ich mich. Sobald ich einen Plan verfolge, kann ich verdammt amtlich werden, wenn ich bei dessen Ausführung gestört werde. Bis hin zur gereizten Unhöflichkeit. Man stelle sich das mal vor. Ich bin mit meinem genormten Zollstock ungefähr in der Mitte der Brücke angekommen. Male eben mit meiner Kreide gewissenhaft eine Markierung auf den Asphalt, als ich hinter meinem gebeugten Rücken etwa folgendermaßen angesprochen werde: „Excuse me“, oder noch verbindlicher: „Excuse me Sir“. Die vorgebliche Höflichkeit bedeutet im Grunde einen Dreck. Selbst der unerzogenste Amerikaner leitet auch die rotzigste Unverfrorenheit beinahe immer mit einer Höflichkeitsformel ein. Amerikanische Verbindlichkeit hat ihren Ursprung also nicht im Entgegenkommen, sondern allein in der Gewohnheit.
Als just sehr beschäftigter Arbeitstourist nehme ich mir das Recht, vor diesem Hintergrundwissen meine eigenen Gepflogenheiten zu pflegen. Anstatt also zu fragen. #simultanübersetzt: „Hallo mein Herr. Wie geht es Ihnen?“ knurre ich nur so etwas wie: „Sehen sie nicht, dass ich beschäftigt bin“? Oder noch ungnädiger: „Hast du keine Augen im Kopf? Ich arbeite“. Ignoriere infolgedessen das lästig lokale Gefloskel.
Möglicherweise werde ich auch folgendermaßen angesprochen. #schüchternsäuselnd: „Hey Mister“. Die Töne kenne ich freilich. Zu Genüge. Gerade aus San Francisco. Da will mir bestimmt einer an die Wäsche. Da ist jede Liebenswürdigkeit vergebene Liebesmüh. Man setzt sich nur dem Verdacht aus, sich eben ein bisschen zu zieren, um sich aufzuwerten oder interessanter zu machen. Jeder der, spitz wie Lumpi, auf der verzweifelten Suche nach einem willigen Stück Arsch ist, scheint nachgerade zwanghaft dasselbe zu glauben – zu hoffen.
Da kannst du spätestens jede zweite Frau fragen. Ich vermag nicht zu begreifen, wie es den meisten Mädels scheinbar mühelos gelingt, angesichts der notgeilen Dauerbeschallung derart stoisch Contenance zu bewahren. Hätte ich eine Handtasche, ich würde damit spätestens nach der dritten Anmache ohne Weiteres auf jeden dieser dummdreisten Liebeskasper einprügeln. Hätte dergestalt vermutlich einen immensen Verbrauch an Handtaschen. Gäbe eher keine sehr damenhafte Dame ab. Denn auch, wenn unheimlich viele Frauen unheimlich gerne unheimlich viele Handtaschen kaufen, tun sie das doch eher selten in der Absicht, brünstige Erotomanen damit abzuschwarten. Sie bewahren all die Taschen und Täschchen, Beutel und Beutelchen einfach jahrelang in ihren Kommoden und Schränkchen auf. Denkbar allein aus dem Grund, um in einem geeigneten Moment bei ihrer besten Freundin Schnappatmung auszulösen. So eine Art Kompensation für den anatomisch unmöglichen Schwanzvergleich. Oder… weshalb auch immer.
Das mit der Neidattacke habe ich mir übrigens gerade ausgedacht, weil ich die Gründe für diese Handtaschenhamsterwut in Wahrheit kein Stück nachvollziehen kann. Und. Ich konnte einfach nicht widerstehen, ein bisschen anzüglich zu orakeln. Was ich allerdings begriffen habe, auch ohne Frau zu sein: Gegen unerwünschte Begehrlichkeiten helfen nur unmissverständliche Botschaften. Also fahre ich den Pegel ansatzlos hoch und empfehle dem Verehrer mit stur zugewandtem Buckel, sich schleunigst zu verpfeifen. Höre wenige Sekunden später einen Schrei, der sich rasch entfernt. Wahlweise mehrere, die sich unter vielfüßigem Getrappel hurtig nähern.
Oh Mann, so schleunig wäre jetzt echt nicht nötig gewesen. Hätte ich mich doch dieses eine Mal nur umgedreht. Die Verzweiflung in den Augen meines Gegenübers gesehen. Da hat ein Mitmensch, der vielleicht noch einmal seinen allerletzten Lebensmut zusammennahm, um Hilfe nachzusuchen, hinter meinem Rücken endgültig seine ganze Welt verloren. Grundgütiger. Nur, weil ich so vernagelt bin. Und vorurteilsbeladen. Wie könnte ich mit einer solchen Schuld jemals fertig werden? Ich werde also einen Teufel tun, die Golden Gate Bridge jemals neu zu vermessen. Zumal jede Messung nur den gerade herrschenden Umweltbedingungen entspräche. Um einen verlässlichen Wert zu ermitteln, bräuchte es deren Dutzende. Unter allen erdenklichen äußeren Bedingungen. So brennend interessiert mich die Länge der Golden Gate nun auch wieder nicht.