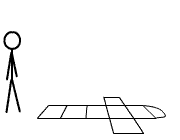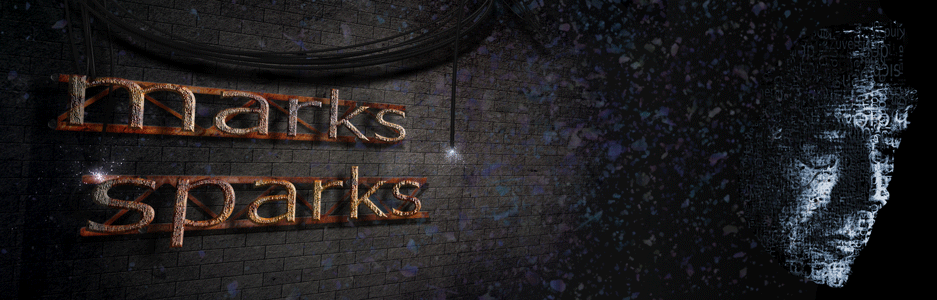Aber wir schreiben das Jahr 1969. Ganz so differenziert dachte ich eher noch nicht. Hingegen gehörten Gedankensprünge bereits zur Grundausstattung. Verhinderten wahrscheinlich die rettende Eins in Deutsch. Zwar waren meine Aufsätze im Allgemeinen recht eindringliche Ausflüge ins gestellte Thema, aber leider nicht immer besonders methodisch. Das bedingte die entscheidenden Abzüge. Mangelnde Methodik stellte seine Existenz auf den Kopf. So ließe sich mein ganzes Dasein auf einen einzigen Satz schrumpeln. Ich wäre nicht sitzengeblieben und meine Zukunft hätte eine ganz andere Wendung genommen. Andere Freunde, andere Frauen, andere Kinder… Der einen oder anderen wäre vielleicht einiges erspart geblieben. Im Umkehrschluss hätte ich womöglich ein bisschen ausgeglichener gelebt. Es wäre allerdings unfair, mit dem Schicksal zu hadern. Kriegst du doch ohnedies meist das, worum du das Leben selbst angebettelt hast. Spätestens bei meinen Kindern hört der Spaß allerdings auf. Die möchte ich um nichts in der Welt eintauschen.
Womöglich wäre ein ganz passabler Archivar aus mir geworden. Mit ein wenig Fortune auch ein Millionär – oder ein Flugkapitän, wenn ich mich reingekniet hätte. Ein Pilot, der mit einer schwebenden Stewardess, knackevoll mit schönen Illusionen, verheiratet wäre. Ein weltberühmter und einsam gebliebener Seiltänzer. Weil du einen solch gefährlichen Job keiner Partnerin zumuten kannst. Und nachdem ich meine Höhenangst in den Griff bekommen hätte. Wäre dergestalt auch in der Lage gewesen, tatsächlich auf die Dächer von Wildspitze und Großglockner zu steigen, um mir selbst ein Bild zu machen, ob’s die dreißig Meter wirklich bringen. Hätte mich als Designer für ausgefallenes Geschirr verwirklicht. Als Psychologe zerbrochene und verlorene Tassen in den Schränken der Patienten gekittet, sortiert und aufgefüllt. Lebensentwürfe, die sämtlich erfüllte Dasein bescheren mögen.
Ich hatte selten einen Plan. Ließ mich unentschlossen von Marotte zu Marotte treiben und dotzte mir die Birne entsprechend oft an. Mit zunehmender Lebenserfahrung wird es allerdings immer billiger, jeden verdammten Ausraster auf ein Zuviel oder Zuwenig an Kindheit zu reduzieren. Die eigene Unausstehlichkeit unbeirrt auf ein paar nebulöse Traumata zu schieben. Banale Neuröschen beharrlich als unverzichtbare Wesenszüge der eigenen, unvergleichlichen Persönlichkeit zu pflegen. Und der halben Welt mit seinen Macken auf den Sack zu gehen. Bei günstigem Verlauf ist man irgendwann so von sich selbst genervt, dass man halt mal was dran macht.
AUKAY. In der zweiten Quinta 1969 tat sich ein neues Fenster für weitergehende Informationen über Amerika auf. Aus erster Hand sozusagen. In Englisch bekam die, mir noch fremde, Klasse einen jovialen älteren Herrn als Lehrer. Mr. Rasmussen trug den stolzen Rauschebart eines Wikingers. Ohne Essenreste und Ungeziefer, nehme ich an. Sprach leise, aber nachdrücklich. Vor allem kaute er die Worte nicht, bevor er sie ausspuckte, sondern zelebrierte das klassische Englisch der Bostoner Oberschicht. Wie er selbst immer wieder betonte. Das sich aus der Sprache britischer Puritaner weiterentwickelte, zu denen er sich, obwohl dänischstämmig, wohl auch irgendwie zählte. Elternhaus in Back Bay, und achte Generation Amerikaner, wie er immer mal wieder einfließen ließ. So selbstbewusst, als entstamme er einem uralten Adelsgeschlecht und das viktorianische Reihenhaus in der Marlborough sei gewissermaßen die Stammburg derer von Rasmussen. Bei aller Schrulligkeit und seinem liebenswürdigen Snobismus war dieser Mann wohltuend warmherzig. Ich habe nie erlebt, dass er einen Mitschüler vor den anderen heruntergeputzt hätte, um sein eigenes Ego an dessen Lächerlichkeit aufzurichten. Was viele Lehrer gern tun, die im Grunde arme Wichte sind und womöglich nur deswegen Lehrer werden. Um endlich aller Welt beweisen zu können, dass sie gar keine Wichte sind.
So machte sich dieser Mann die Mühe, mit hunderten selbstgefertigten Dias und seiner Lieblingsmusik Multimediashows über seine Heimat zusammenzustellen, als in Deutschland noch kaum ein Mensch an sowas dachte. Ich könnte nicht mehr behaupten, er habe als Untermalung Dave Brubeck bevorzugt, Ray Charles oder etwas wie die Chordettes und Perry Como. Erinnere mich nur, dass er während dieser Stunden noch glücklicher als sonst lächelte und es bei seinen Diashows eigentlich immer um Boston ging. Um sein Boston präziser.
All die knistrigen Schwarzweißfilme, die er werweißwoher nahm, zeigten ausschließlich Lebens- und Arbeitswelt der USA. Auch sie handelten von jener rundum zufriedenen Welt, die ich von meinem Onkel her kannte. Eines fiel mir irgendwann auf. In all den mitgebrachten Filmen kam immer nur der Osten der USA vor. Vielleicht mochte Mr. Rasmussen den hemdsärmeligen Mittelwesten mit der einschläfernden Gleichförmigkeit seiner Agrarlandschaften nicht. Den unmanierlichen Westen mit den ruppigen Viehtreibern. Die Staaten am Pazifik, die Asien in so ziemlich jeder Beziehung näher sind, als Europa. Die zivilisierte USA hörte für Mister Rasmussen sehr offensichtlich hinter dem damaligen Manufacturing Belt auf. Der aus fatalen Gründen längst unter dem Namen Rust Belt geläufiger ist. Ich nehme trotzdem an, dass außer mir damals den Wenigsten auffiel, dass die Vereinigten Staaten hinter Illinois oder Wisconsin noch lange nicht zu Ende sind.
Im Halbjahreszeugnis war ich von einer abonnierten Drei in Englisch auf eine gute Zwei geklettert und am Ende der Quinta II hätte ich sogar eine weitere Sechs in Mathe ausgleichen können. So war es immer. Wenn ein Lehrer bereit war, sich selbst einzubringen, wenn er Engagement und Liebe für seinen Beruf zeigte, zog ich an. Schon, um meine Wertschätzung zu beweisen. Dass da ein Mensch noch immer von seiner Aufgabe beflügelt war, und sich nicht auf Routine ausruhte. Oder beleidigt auf seine Desillusionen über dumme Schüler und Intrigen im Lehrerzimmer zurückzog. Was für mich der schlüssige Beweis ist, dass zu viel Talent durch uninspirierte Lehrer untergepflügt wird.
Heute wohne ich gegenüber einer Schule. Jedes neue Schuljahr leuchten die Gesichter von Abc-Schützen buchstäblich aus der Menge heraus. Kleine Menschen, die sich einfach nur auf ihre Zukunft freuen. Ich sehe gespannte Erwartung, nehme den Stolz dahinter wahr, nicht mehr zu den Kleinen im Kindergarten zu gehören. Glaube, in beinahe jedem der Kindergesichter die unbedingte Bereitschaft zu erkennen, zu lernen.
Sehe jedes Jahr meine kleine Tochter, wie unbändig sie sich damals auf die Schule freute. Sie vertraute darauf, dass die Lehrer so integer wären, wie ihre Eltern, wie die ErzieherInnen im Kindergarten. Verließ sich darauf, dass sie als Rahmenbedingung erwartete, was sie kannte. Diese Gewissheit und ihr Selbstverständnis waren stabil genug, jede Zuversicht zu tragen. Sie war ein starkes Kind, weil sie nicht oft enttäuscht worden war. Konnte gar nicht genug davon bekommen, Schule mit uns zu spielen.
In den ersten zwei Klassen lief alles bestens. Ab der dritten Klasse ließ ihre Begeisterung für die Schule merklich nach. Eine zunehmend überforderte Klassenlehrerin, die Mobbing nicht bemerken wollte, konnte, oder duldete. Ein selbstgerechter Fatzke von einem Rektor, der schon mit seiner Eitelkeit komplett ausgelastet war. Der seine Verärgerung darüber, auch in gehobener Position begriffsstutzigen Gören Mathematik nahebringen zu müssen, permanent anklagend zur Schau stellte. Seinen Frust an diesen Kindern ausließ. Man konnte ihm die Geringschätzung ohne Weiteres ansehen, mit der er in der großen Pause auf dem Hof umherstolzierte, um jeden lebensfroheren Schüler sogleich auszubremsen. Die verheerende Kombination beider schulischer Bezugspersonen nahm Marie zunehmend den Spaß an der Schule überhaupt. Selbst im Spiel wollte sie längst keine Lehrerin mehr sein.
Der freundliche Herr mit der Wikingermatte entschwand zu meinem Leidwesen nach seinem Mannheimer Intermezzo viel zu schnell wieder in seine geliebte Heimat und ich rutschte in der Quarta erwartungsgemäß über eine Zwei auf die erfaulenzte Drei.
In Alabama steht eine Mutter vor einem ausgeschnittenen Karree im Boden. Sie trauert um ihr totes Kind, dem sie ein ärmliches Begräbnis ausrichtet. In der Hand hält sie eine feingliedrige Holzpuppe, die ihr Ältester noch vor ein paar Wochen für sie geschnitzt hat. Damit sie immer an ihn denke. Joe war schneller als ein flüchtendes Reh und wollte eines Tages eine Goldmedaille für sein Land gewinnen. Für seine große Nation und für sie. Er hatte sie wortlos in den Arm genommen und sie weinte ein bisschen. Dachte an ihren ersten Mann, der in Korea sein Leben fürs Vaterland gab, als sie noch ganz jung und Joe noch ganz klein war. Vielleicht ahnte sie in diesem Moment schon, dass auch ihr Junge nicht wiederkommen würde. Joe ist noch keine Achtzehn und noch in der Ausbildung, als ihm eine übersehene Mine die schnellen Beine wegreißt. Achtundvierzig Stunden später ist er tot.
Im gleichen Moment reihen sich in Arlington flaggenbedeckte Särge jener Soldaten, denen noch die Zeit gegeben war, Helden für ihr Land werden zu dürfen. Zu den Klängen der Nationalhymne sinkt das Sternenbanner feierlich auf Halbmast. Feuchte Augen. Unterlippen beben überwältigt. Zum Zapfenstreich werden die Fahnen synchron von den Särgen angehoben und gemäß soldatischer Vorschrift gefaltet. Schließlich das Defilee der Kameraden. Der abgewinkelte Unterarm bildet eine Gerade von der Elle bis zu den Fingerspitzen. Deutet auf die rechte Schläfe. Unter mancher bügelgefalteten Uniformhose zeichnet sich eine Erektion der Ergriffenheit ab. Vielleicht träumen einige insgeheim davon, selbst auserkoren zu sein. Fürs Vaterland fallen zu dürfen. Drei Schüsse Salut beenden das verstörende Ritual. Drei Schüsse für absurde Opfer, unerfüllte Träume und viel zu kurzes Leben.
All das ist so entsetzlich trivial. Gravitätisch. Monströs. Inhaltslos. Wie so vieles in Gottes eigener Nation. Geheuchelte Trauer, aufgesetzte Anteilnahme, abgewichstes Pathos und Zweitaktmusik aus der untersten Schublade. Das ist das perfide Rezept, mit dem Politik seit jeher klebrige Gefühle adressiert. Während sie gleichzeitig auf die Schicksale dahinter scheißt. Eine Seifenoper, die in all ihren Bestandteilen an niederste Instinkte appelliert und sich immer wieder und beinahe trotzig wiederholt. Das immerwährende Deja Vu eines Totenrituals, in dem der Pomp alles ist – und die Gefallenen und ihre Hinterbliebenen nichts. Kein westliches Land hat die Showveranstaltungen rund um die sterile Entsorgung seiner Soldatenleichen so perfektioniert, wie die Vereinigten Staaten.
Eine gebrochene Frau über einem offenen Grab. Ihre elementare Erschütterung greift den Mittrauernden ans Herz und nicht nach dem Schwanz. Auch morgen werden die jüngeren Geschwister des Toten im Bus wieder hinten sitzen. Damit die Weißen vorne ihren Gestank nicht ertragen müssen. In einem Land, das doch längst ihre Heimat sein sollte. In einer Nation, die ihren Vorfahren einst in Ketten aufgezwungen wurde. Die eine Heimat hatten, in der sie zu Hause waren. Freie Menschen meist, die nicht selten von ihren eigenen Anführern an Sklavenhändler verkauft wurden, waren auf einmal zu „Niggern“ geworden.
Man nahm ihnen ihre Heimat und ihre Freiheit, ja man beraubte sie ihres Menschseins und degradierte sie zu Tieren. Führte sie in den Inventarlisten neben Rindern und Hühnern, Spitzhacken und Pflügen, damit die weißen Christenmenschen nicht mit ihrer menschenliebenden Religion und einer philanthropischen Verfassung durcheinanderkamen. Von wegen geringsten Brüdern, Gleichheit und all dem batzweichen Salbader. Schließlich nahm man ihnen auch ihre afrikanischen Namen und damit die Identität. Weil Ihre Besitzer zu blöde oder zu faul waren, sich diese zu merken. Diese nannten sie fortan Jim und Joe, Tom und Moe. Mary und Betty, Milly und Hetty.
Als ihre zweibeinigen Arbeitstiere schließlich befreit wurden, weil der Ausgang des Sezessionskriegs entschieden hatte, dass sie streng genommen gar keine Tiere seien, sondern einfach nur „Nigger“, waren sie deshalb noch lange nicht frei. Diese Befreiung machte vieles sogar noch unerträglicher. Die gewonnene Freiheit wurde umgehend durch neue, auf sie zugeschnittene, Gesetze beschnitten. Die Heimatlosen hatten zudem längst vergessen, wie es sich anfühlte, frei zu sein und ihre ehemaligen Besitzer taten einen Teufel, sie daran zu erinnern. Entlohnten sie nun für ihre Fron so schäbig, dass es nicht mal zum Überleben reichte. Vermietete den „Feldnegern“ die Sklavenhütten und verkaufte ihnen die notwendige Nahrung. „Hausnegern“, also ihren Dienstboten, verfütterten sie, als seien sie Hunde, was von den eigenen Tischen abfiel. Die Hunde hatten für dieselben Brocken nur zu gehorchen.
Durch dieses perfide System von Hungerlöhnen und wirtschaftlicher Abhängigkeit häuften die Arbeiter immer mehr Schulden bei ihnen an. Konnten den Plantagen ihrer Herren niemals den Rücken kehren, um vielleicht anderswo ein selbstbestimmteres Leben beginnen zu können. Sie waren von Sklaven zu Zwangsarbeitern geworden. Die immerhin ihre Namen selbst wählen durften. Hatten freilich über die Jahrhunderte längst jeden Bezug zur eigenen Identität verloren. Gaben ihren Jungs nun selbst „Niggernamen“ wie Jim und Joe, Tom und Moe, weil sie sich an die afrikanischen Namen ihrer Ahnen meist gar nicht mehr erinnerten. Schwarze Frauen wollten Mary und Milly heißen, weil das in ihren Ohren geläufiger klang, als Elani oder Imani.
Ihre Herren bedienten sich weiterhin an ihren Körpern, wenn sie ihre Macht demonstrieren wollten. Knüpften ihre Männer auf, wenn ihnen danach war, einem Menschen bei seinem eigenen Totentanz zuzusehen. Die Knechte kannten nichts als die Arbeit auf „ihren“ Plantagen, die nicht selten so weitläufig waren wie anderswo ganze Länder. Formal aufgehoben wurde die Rassentrennung erst 1948 – und zunächst auch ausschließlich in den Streitkräften. Mithin als es galt, auch in Korea den „American Way of Life“ rücksichtslos durchzusetzen. Von dem freilich die Schwarzen zu allerletzt selbst etwas hatten. Andererseits durften sie ihren Patriotismus nun Seit an Seit beweisen und neben den Herrenmenschen ins gleiche Gras beißen.
Auch uramerikanische Namen wie Leyati und Kajika, Nirvelli oder Rayen waren durch eingeschleppte Krankheiten und Metzeleien rar geworden. Deren einst so stolze Träger betäubten ihre Erinnerungen in den Reservationen mit viel Feuerwasser oder tingelten in erbärmlichen Western Shows. Wie sie beispielsweise Bill Cody, besser bekannt als Buffalo Bill, schon im späten 19. Jahrhundert zum Geschäftsmodell gemacht hatte. Auch große Namen wie Tȟatȟáŋka Íyotake, aka Sitting Bull, schenkten ihre Historie in Codys Wildwesttheater endgültig ab. Der Häuptling der Sioux profanierte die eigene Tapferkeit ungewollt. Man hatte ihm das Mittun mit der Möglichkeit schmackhaft gemacht, die Zuschauer endlich einmal für seine eigene Version der Geschichte einnehmen zu können. Da er ausschließlich Lakota sprach, verstand ihn nur keiner von denen, die er erreichen wollte. Der Übersetzer übersetzte einfach, was Cody ins Bild passte. In Wahrheit durften die Indianer nur mitspielen, um die vermeintlichen Großtaten weißer Heroen in ein gewünschtes Licht zu rücken. Es war eigentlich wie immer, wenn sich Eroberer eine fremde Welt dreist unter den Nagel reißen. Am Ende dürfen sich die Usurpatoren nicht nur gesellschaftlich, sondern auch moralisch überlegen fühlen. Und die Ureinwohner sind in jedem Fall die Angeschissenen.
Ich habe übrigens ein solches, angeblich authentisches Powwow in den frühen Neunzigern einmal mit eigenen Augen mitangesehen. In Spokane war das. Wir waren damals bei der Durchfahrt über die Plakate am Straßenrand gestolpert. Es nahm einen mit, wie sich die immer wieder Betrogenen in bügelfreien Fantasiekostümen vor schaulustigen Touristen abzappelten. Wie sie für die rausgefressenen Nachfahren jener rumkasperten, die einst ihre Vorfahren ohne weiteres abgeschlachtet hatten. Wie erschreckend willfährig sie sich gegen Bezahlung in ihr eigenes Klischee verwandelten. Sich nach der peinlichen Vorstellung willenlos die Kante gaben, bis sie einfach umfielen und einschliefen, wo sie gerade herumtorkelten, saßen oder schon lagerten.
1970. Der Onkel wusste Rat, wenn sich der orientierungslose Neffe verrannt hatte. Ich beneidete seine Kinder. Kinder die ihm freilich niemals zugefallen waren. Die Frauen, die ihm zugesagt hätten, zeigten kein Interesse an ihm. Er verehrte ätherische Geschöpfe wie Audrey Hepburn, war in seinem eigenen Äußeren aber eher hausbacken geraten. Das war seine Version und ich machte sie mir gerne zu eigen, weil sie an meine Sentimentalität appellierte. Ich erinnere ihn bereits als Endzwanziger mit Glatze, einer Goldrandbrille mit klappbaren Sonnengläsern und seinem Wohlstandsbäuchlein. Nur an wenigen kleinen Kringeln seines Haarkranzes ließ sich erkennen, dass er als Kind wohl einmal blondgelockt gewesen war. In meiner Familie hielten sich hartnäckig Gerüchte über eine denkbare sexuelle „Fehlorientierung“. Spekulationen, über die ich mich maßlos ärgerte. Von mir wollte er jedenfalls nichts und es war mir damals tatsächlich so wurscht wie heute, ob er auch Männer erotisch fand. Für mich war der Onkel einfach ein kultivierter und hochanständiger Mensch, schüchterner Verehrer der Grazie einer jungen amerikanischen Schauspielerin.
1971 begann ich zunehmend mein eigenes Leben zu leben. Emanzipierte mich insbesondere politisch von meinen Eltern und dem Onkel. Nabelte mich von jener Generation ab, die den Krieg noch am eigenen Leib erlebt hatte. Zunächst ging’s mal kompromisslos in die entgegengesetzte Richtung. Relativ normal für einen Fünfzehnjährigen eben. Ein neuer Lehrertypus hielt Einzug in Lehrerzimmer und Schulklassen. Lehrer, die von ihren Schülern geduzt werden wollten und diese damit gewissermaßen auf die eigene gesellschaftliche Ebene hoben. Die morgens Schulwissen vermittelten und nachmittags in den eigenen vier Wänden zum Tee baten. Ihren schwärmerischen Gästen neben selbstgebackenen Mürbeteilchen ganz beiläufig ihre Überzeugungen kredenzten. Damals war ich naturgemäß geschmeichelt, bei meinen Lehrerinnen wie einer ihrer Kumpel ein und aus gehen zu dürfen. In der Rückschau finde ich die nachmittägliche Nachwuchskaderschulung einigermaßen befremdlich.
Ich lernte zum Beispiel, dass Kommunisten nicht einfach Kommunisten sind. Dass es, durch die ideologische Brille gesehen, durchaus einen gewaltigen Unterschied machte, welche Großmacht welche Völker mit welcher Zielsetzung eindoste. Uschi verstand sich als Trotzkistin, während Ursel dem Maoismus anhing. Uschis Liebster hörte übrigens auf den stolzen Namen Leo. Trug Nickelbrille und Spitzbärtchen. Dozierte linientreu und in wohlformulierten Satzbausteinen. Was nicht unerheblich zu ihrer Begeisterung für Beide beigetragen haben wird. Sofarevoluzzer sind meist nicht nur entsetzlich engstirnig, sie können auch gnadenlos sentimental sein. Uschi verstand keinen Spaß, wenn man an Trotzkis Denkmal kratzte. Schließlich war der große Revolutionär für seine Überzeugung gestorben. Ich erinnere mich nicht, ob ich mich schon damals fragte, was eigentlich einen politischen Märtyrer von jenen der geistlichen Eiferer unterscheidet? Hier wie da taugen Opfer natürlich bestens dazu, Anschauungen zu emotionalisieren, sobald die Argumentationsdecke löchrig wird. Die Opfertode des heiligen Stephanus und Lew Bronsteins sind nur zwei Seiten derselben Medaille. Der eine schaffte es immerhin in den Himmel, während der andere nur ewig tot ist und allenfalls in anhänglichen Herzen noch ein Plätzchen hat.
Im Grunde bauen aber alle Ideologien auf dem gleichen Erfolgsrezept auf. Aus möglichst vielen Orientierungslosen eine homogene Masse zu formen und deren Loyalität zur gemeinsamen Gesinnung mit viel ideellem oder jenseitigem Lohn entgelten. Fast immer ein Selbstläufer und nicht selten einträgliches Konzept für die Ideenstifter. Wer übrigens selbst relativ günstig Märtyrer werden möchte, hat momentan bei den Islamisten ganz gute Karten. Man muss sich nur an ein paar Vorgaben halten, dann geht alles andere seinen Gang. Im Paradies warten neben hohen Ehren auch einige sehr spezielle Goodies auf aufgehetzte Fusselbärte.
Die ideologischen Sperrfeuer, zwischen die ich damals geraten war, hatten durchaus ihre Vorteile. Eines Tages musste ich beinahe zwangsläufig begreifen, dass Weltanschauungen in erster Linie Regulierungen für programmatisch Mäandernde sind. Dass Reaktionäre, Revisionisten, Revolutionäre, Fanatiker oder Pfaffen ihre rechthaberischen Rezepturen primär aus Gründen der eigenen Selbstbefriedigung verbreiten. Manche werden tatsächlich glauben, das Leben endlich verstanden zu haben und wollen nun unbedingt alle Welt an ihrer Erleuchtung teilhaben lassen. Halten eher gehaltlose philosophische Flatulenzen und den Schulterschluss plötzlich als unverzichtbar für die Sinnhaftigkeit allen menschlichen Daseins.
In dergleichen Fehlschlüssen liegt auch die Krux jeder hypothetischen Umsturzbestrebung. Weil viele dieser Vorturner eben selbst so hingerissen von ihren kategorischen Hirnblähungen sind, dass sie dabei die Voraussetzungen für ein Aufgehen ihrer missionarischen Saat aus den Augen verlieren. Können die individuellen Bedürfnisse derer, die sie doch ins Licht führen wollten, gar nicht mehr wahrnehmen. Elementare Veränderungen werden auch nur durch einen substanziellen Leidensdruck der Betroffenen Aussicht auf Erfolg haben. Eine Revolution kannst du nicht ernsthaft anschieben wollen, solange sich eine satte Mehrheit in der eigenen Lebenssituation einigermaßen komfortabel eingerichtet hat.
Auch mein heiles Amerikabild fiel damals zusehends auseinander. Die Bilder, als sich die letzten Amis auf dem Dach ihrer Botschaft in Saigon mit randvollen Buxen in die Helikopter drängelten, lösten bei mir vor allem Häme aus. Ich genoss, als diese, in ihrer Waffenstärke tausendfach überlegene, Armee am Ende heillos evakuiert werden musste. Wie imperiale Selbstgefälligkeit gedemütigt und mit eingekniffenem Schwanz Leine zog, als die Legende vom gerechten Krieg einmal mehr in nichts zusammenfiel. Für mich ist dieser panische Abzug noch heute ein Lehrstück der Überlegenheit unbedingten Willens über tumbe Überheblichkeit. Unabhängig von jedem politischen Standpunkt.
Was der Onkel dachte, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich äußerte er sich dahingehend nicht. Jedenfalls nicht mir gegenüber. Ich wünsche mir, dass er sich vor allem für die Menschen in Vietnam freute. Er war sicher alles andere als ein Linker, aber auch kein kompromissloser Antikommunist. Hingegen könnte ich meinem Onkel nicht unterstellen, dass er mich bewusst in eine christlich konservative Ecke zu drängen suchte. Bin mir ja nicht mal sicher, ob er überhaupt selbst dort zu verorten war. Ich meine, er war ein Wanderer zwischen den Welten. Mit Liebe für das Hergebrachte, der Loyalität eines Angestellten und einem Hang zum Verklärenden. Mit dem Wissen um eine ziemlich kaputte Nation und dem gleichzeitigen Unwillen, die Fakten auch zu akzeptieren. Vielleicht erzählte er nur mir vom idealen Amerika seiner Träume. Weil er wusste, wie gerne ich selber träumte. Allein seine intellektuelle Souveränität verschaffte ihm eine enorme Suggestionskraft. Schließlich haben die Miniaturen der Städte und Landschaften, jene Welt zwischen Atlantik und Pazifik, die er auch für mich zuweilen entwarf, lange Jahre meine eigenen Bilder von den Vereinigten Staaten bestimmt.
In Wirklichkeit besuchte mein Onkel Karlheinz Amerika auch nicht ein einziges Mal. Unsere spannenden Reisen über den Atlantik fußten samt und sonders auf seinen Kopfgeburten und meiner Vorstellungskraft. Er zählte die Subjektivismen seiner vielschichtigen Kontakte in der Bücherei zusammen und ergänzte sie durch eigene Vorstellungen. Die aus zahllosen Büchern geboren waren, aus amerikanischen Filmen und seinen Idealen. Ich kann nur darüber spekulieren, warum er seine Sehnsuchtsorte nie selbst besuchte. Er verfügte über die Mittel und hätte die Zeit gehabt. War unabhängig und beliebt in der amerikanischen Gemeinde. Hätte mit dem Finger auf einer Karte der USA blind ein Ziel herausdeuten können und wäre unwillkürlich ein wenig zu Hause gewesen. Womöglich mochte er die Klarheit seiner Fantasiestädte, den Überfluss der Kulturlandschaften, die gewaltige Natur und einem Leben, welches er seinen Kulissen nach Belieben einhauchte. In denen sich Gewalt, Verfall und Armut nur in Statistiken wiederfanden. Wo Gestank und unangenehme Geschmacksaromen keinen Platz hatten. Denn diese kommen ebenfalls nur in der Wirklichkeit vor. Bestenfalls in der verwaschenen Erinnerung an eine vergangene Wirklichkeit.
Vielleicht hatte er auch nur Flugangst. Oder Panik, seiner Mutter könne während seiner Abwesenheit etwas Schreckliches widerfahren. Dergleichen Ängste sollen durchaus verbreitet sein. Am wahrscheinlichsten scheint mir dennoch, dass er an jenem Amerikaidyll, das er in seinem Kopf gebastelt hatte, festhalten wollte. So wie er sich die entzückendsten Partnerinnen an seine Seite träumte. Wohl wissend, dass sie ihm ohnedies nie zu nah kommen würden. Aber lassen wir das. Es hilft nicht, sich seinen Kopf zu zerbrechen, denn auch irgendeine beliebige Gewissheit änderte nichts. Auch sind alle, die mir vielleicht Auskunft geben könnten, längst tot. Ich habe einfach zu lange gewartet mit meinen Fragen.
Ich war beinahe dreißig, als ich schließlich das erste Mal nach Amerika reiste. Physisch. War zwischenzeitlich so oft in den Staaten, dass ich nicht mal beschwören möchte, mein erstes Ziel sei Florida gewesen. Ich könnte meine Frau befragen, die ihre Fotoalben mit Hingabe und Akribie führt. Aber vielleicht wäre sie traurig darüber, dass ich die genaue Reihenfolge unserer gemeinsamen Reisen vergessen habe, und ich möchte alles andere, als dass sie sich jemals wieder über mich grämt. Onkel Karlheinz war damals bereits tot. Ich erinnere mich, dass ich ihm gerne von meinen eigenen Erlebnissen berichtet hätte. Ein aggressiver Krebs hatte ihm am Ende den ganzen Kiefer zerfressen. Zu viele Zigaretten. Solch einen jämmerlichen Tod hat keiner verdient. Die Besten tritt das Schicksal oft am unbarmherzigsten in den Arsch.
Mir gelang es immer seltener, die vor langer Zeit gepflanzten Bilder in meinem Kopf festzuhalten. Vielleicht mied ich während der ersten Amerikareisen sogar unbewusst längere Aufenthalte, um vielleicht gar nicht so genau hinsehen zu müssen. Oberflächlich zu bleiben, damit ich mich nicht selbst desillusionierte. Jene Bilder in meinem Kopf zu behalten, die mir ans Herz gewachsen waren, wie mein Onkel. Irgendwann musst du einfach akzeptieren, dass du deine naiven Vorstellungen nicht ängstlich festhalten kannst, wenn du neugierig bleiben willst. Musst lernen, mit wachen Sinnen zu reisen und selbst das Abstoßendste als Teil des Liebgewonnenen zu begreifen.
Mittlerweile ist mein Verhältnis zu den USA ein außerordentlich ambivalentes. Ein Land mit einer großartigen Natur, ohne jeden Zweifel. Aber auch gesät mit unbegreiflich bornierten Intellektuellen und waffenstarrenden Schwachköpfen. In dem mir der Unterschied zwischen schamlosem Protz und denen, die den Kopf dafür in jeder Beziehung hinhalten müssen, stets augenfälliger wurde, als sonstwo. In dem sich ein verdammt hoher Anspruch und die Niederungen der Realität so fremd bleiben, wie nur irgend denkbar. Amerika mag das großartigste Land der Welt sein. Für gestopfte Amerikaner, eine saturierte weiße Mittelschicht, oder für Touristen, die gern selektiv reisen und nur das ansehen, was sie ohnehin schon im Kino oder in Fernsehsendungen super fanden. Gerade in den Dauerserien der privaten Sendeanstalten sind die selbstdarstellenden USA schließlich omnipräsent.
Für meinen Teil meine ich, längst genug vom realen Amerika gesehen zu haben, um mir ein eigenes Urteil bilden zu können. Es zieht mich einfach nicht mehr über den großen Teich. Mein amerikanischer Traum hatte der Wirklichkeit nie standhalten können, wenngleich ich naturgemäß auch einiges Erinnernswertes erlebt habe. Womöglich waren die Erwartungen von Beginn an zu hoch. Die Rückblenden müssen nun vorhalten, bis ich sterbe, was soll ich noch dort? Aber so weit sind wir noch nicht. Wir befinden uns mitten in den Achtzigern und kurven im Sunbelt rum.
Rastlosigkeit fiel mir damals nicht schwer. Ich liebte es ja ohnedies, ganze Tage flüchtige Eindrücke und Strecke zu fressen. Schon deshalb mietete ich auf jeder Fernreise als örtliches Fortbewegungsmittel gern die komfortable Premiumklasse, die das Unterwegssein zum Vergnügen macht. Geräumige Wagen, deren Dach nach Möglichkeit die Wolken sein sollten. In meines Onkels Geschichten von Amerika waren Autofahrten hingegen nicht mal als Randnotiz vorgekommen. Autos waren ihm, ich erwähnte es bereits, völlig einerlei. Vielleicht entdeckte er in seinen Träumen die amerikanischen Städte mit dem Fahrrad, das rechte Hosenbein mit einer Metallklammer gegen Unbill geschützt. Ich möchte mit dieser Vorstellung in keiner Weise despektierlich sein. Bin weit davon entfernt, einen billigen Witz auf seine Figur zu reißen.
Was ich sagen will: Ist es nicht vielmehr so, dass jeder sich in seinen eigenen Gewohnheiten am einfachsten zurechtfindet und diese entsprechend in seine Tagträume einbindet? Warum also hätte er sich in einen Cadillac träumen sollen, er hatte ja nicht mal einen Führerschein? Vielleicht als Audrey Hepburns Beifahrer, das ginge natürlich. Doch. Audrey und Karlheinz cruisen in einem offenen Caddy in den Sonnenuntergang. Was sich als Satz für sich reichlich albern anhört, wäre ihm realiter sicher total reingegangen. Hatte er doch eine romantische Ader, die er nicht immer verbergen konnte.
Vor allem entdeckte ich Unerwartetes. Dass man bei Autofahrten in Florida recht entspannt auf die Müdigkeit warten kann. Wenn man seinerzeit in Europa unterwegs war, tat man ohne Buchung gut daran, frühzeitig nach einem Nachtlager Ausschau halten. Die zufälligen Hotels der ersten Reisen ins Frankreich in den späten Siebzigern erinnere ich erschreckend häufig als Wanzenburgen. Was natürlich nicht unwesentlich mit dem damaligen Reisebudget zusammenhing. In den USA vergingen selbst in Transitregionen, zwischen dem Entschluss zu übernachten und dem Bezug eines Zimmers, oft nur wenige Minuten. Das ging geradeso geschmeidig, wie einen plötzlichen Hunger umgehend mit einem Burger, Taco oder Fried Chicken zu stopfen. Immerhin habe ich diese Erfahrung beinahe überall an der Ostküste gemacht.
In sehr dünn besiedelten Gebieten wie großen Teilen von Nevada oder Arizona verhielt es sich naturgemäß ein bisschen anders. Wenngleich auch in den Wüstenstaaten plötzlich Motels wie Sinnestäuschungen auftauchen können, wo man eigentlich nichts als leere Gegend vermuten sollte. Damals aber bereiste ich Florida und war von der Infrastruktur für Durchreisende schwer beeindruckt. Muss einschränkend anfügen, dass meine Begeisterungsfähigkeit mit zunehmendem Alter erschreckend abnimmt. Wenn ich heute in der Fremde unterwegs bin, glaube ich manchmal ein bisschen von oben herab, alles schon mal gesehen zu haben. Was natürlich objektiver Kokolores ist.
Selbst wer eine bestimmte Motelkette bevorzugt, wird bereits eine Stunde später im Bett liegen. In diesem Fall gleicht das Zimmer dann jenem der Vornacht so verwirrend, dass man zu zweifeln beginnt, ob man nicht im Kreis gefahren- und im nämlichen Motel gelandet ist. Manchmal wachte ich morgens auf und wähnte hunderte Meilen des vergangenen Tages als Selbsttäuschung oder besonders realistischen Traum. Zudem riecht jedes Gastzimmer noch immer gleich. Wenigstens war das vor einigen Jahren so. Vielleicht hat sich das Bukett mittlerweile geändert. Ich fahre ja nun nicht mehr hin, um mit aktuelleren Geruchsmeldungen dienen zu können. Auch über mehrere Jahrzehnte hinweg konnte ich nie rausfinden, ob das unangenehm Chemische von Desinfektionsmitteln oder einem unfehlbar tödlichen Gift gegen die floridianischen Monsterschaben herrührte. Jedenfalls ist man immer gottfroh, wenn man wieder auf der Straße ist.