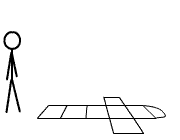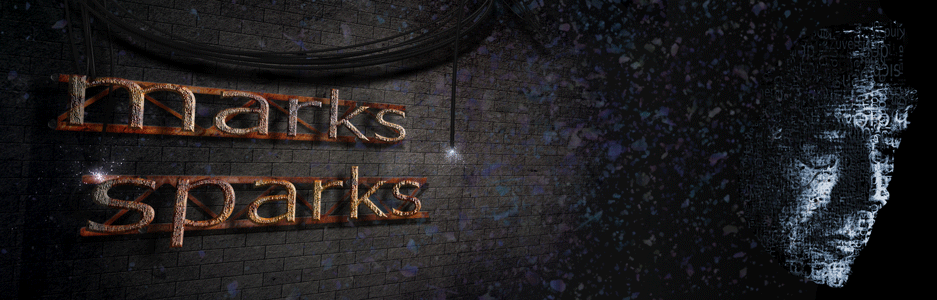Ohne eine weitere Reise, in deren Verlauf ich mich erstmalig ohne Wenn und Aber auf Amerika einlassen konnte, wäre diese Geschichte nicht vollständig. Ich reiste gern mit meinem Freund Oliver. Der etwa in den gleichen Geschäften unterwegs war, wie ich selbst, wenngleich wesentlich erfolgreicher. Ich habe ihm den Erfolg nie geneidet, der ja nicht von ungefähr kam Oliver ging ungleich zielstrebiger zu Werke als ich. Besaß diesen unbedingten Willen, den es braucht, um es wirtschaftlich zu was zu bringen. Verfügte über jene konkrete Vorstellung von seiner eigenen Zukunft, die mir völlig abging.
Ihm war glückhaft zugefallen, was mir versagt war. Er hatte einen Onkel in Amerika. Der Herman hieß und zu den umgänglichsten Menschen zählt, die meinen Weg gekreuzt haben. Andererseits hatte Herman nicht unbedingt die hellsten Lampen am Fahrrad. Oliver meinte einmal, der freundliche Onkel könne sehr wohl äußerst ungnädig werden, wenn etwas nicht so lief, wie er meinte, dass es zu laufen habe. Ich kann das aber nicht behaupten, weil ich ihn so nie erlebt habe. Indessen war auch Herman kein blutsverwandter Onkel, sondern ein angeheirateter. Er nannte ein gepflegtes Häuschen in Lynbrook auf Long Island sein Eigen und war nach Sergeant Metzger geworden.
Während ich gerade Metzger denke, fällt mir auf, dass ich in meinem ganzen Leben nie einem Metzger begegnet bin, der fühllos oder gar brutal gewesen wäre. Metzger haben wahrscheinlich durch die Bank ein empfindsames Gemüt. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte: Der Berufsstand des Schlachters bringt die meisten Sensibelchen aller Berufe hervor. Jedenfalls nach meiner persönlichen Erfahrung. Auch wenn ich tatsächlich gar nicht mit sehr vielen Metzgern bekannt bin, was ich andererseits auch einräumen muss. Könnte meine Metzgerbekanntschaften wahrscheinlich leicht an einer Hand abzählen. Die potentielle Fehlerquote meiner Einschätzung ist mithin hoch.
Egal. Herman war sowieso längst im Ruhestand. Lümmelte den halben Tag in seinem schweren Sessel und gab den Katzen allerlei Namen. Ließ jeder einzelnen nach dem Ableben ein geradezu fürstliches Begräbnis zukommen. Bei Herman hatte ich immer das Gefühl, man könne ihm beim Denken zusehen. Er kicherte in der Stunde bestimmt zehnmal, weil ihm ein possierlicher Gedanke durch den Kopf stolperte. Wischte sich alle paar Minuten eine Träne aus den Augenwinkeln, weil er an etwas Trauriges gedacht hatte. Wenigstens habe ich mir das so zurechtgelegt. Wobei ich der Vollständigkeit halber noch anfügen möchte, dass Staatsbegräbnisse auch für Haustiere in den USA durchaus nichts Außergewöhnliches sind.
So sehr ich mich darum drücken möchte, mich der zugehörigen Tante zuzuwenden, sehe ich doch ein, dass neben allem Anstand schon die Vollständigkeit gebietet, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Ohne ihr Zutun wäre ja aus Herman niemals Olivers Onkel in Amerika geworden. Unsere Reise hätte so nicht stattgefunden. Keine Tante in Amerika, keine Meißner Servierplatte, kein spontaner Flug über den großen Teich, keine Geschichte. So einfach ist das manchmal. Sich diesem Unikum in ein paar wenigen Sätzen zu nähern, ist allerdings ein beinahe aussichtsloses Unterfangen. Ich will es trotzdem versuchen. Die Tante hatte Deutschland 1946 mit Herman verlassen und war, der Bequemlichkeit halber, in ihren Ansichten einfach im tausendjährigen Reich steckengeblieben. Tauschte in ihrer Weltsicht Juden kurzerhand gegen Afroamerikaner. Die sie unverdrossen „Neger“ nannte und nun als Schuldige für jegliche Art menschliche Unbill ausgemacht hatte. War dafür mit einigen Juden aus ihrem neuen Milieu ganz dicke, wie man so sagt. Als hätte sie noch nie was von Antisemitismus gehört.
Anfänglich war ich völlig entsetzt, wie geflissentlich sie von „Untermenschen“ sprach, wenn sie über andere Ethnien redete. Eben diese völlige Selbstverständlichkeit war es dann, die mich nach und nach zu folgender Überlegung brachte. Die Tante musste komplett aus ihrer Umlaufbahn geraten sein. Trudelte seit Jahrzehnten völlig orientierungslos im leeren Raum. Konnte sich nie verzeihen, sich mit Vorsatz für einen Mann entschieden zu haben, der nie etwas anderes als eine finanziell gesicherte Zukunft in einer unzerstörten Heimat in die Waagschale werfen konnte. Den sie als gleichwertigen Partner, wahrscheinlich von Beginn an, nicht akzeptieren konnte. Kalkuliert zu haben, wo man allein auf sein Herz hören sollte.
In einem völlig zerstörten Land mussten die GI’s wie Paradiesvögel gewirkt haben. Mochten den kriegsmüden Frolleins mit ihrer freigiebigen Art, ihrem grenzenlosen Ego und den glänzenden Perspektiven wie personifizierte Verheißungen erschienen sein. Als Heimkehrer in ihr eigenes Land wird der Heldenbonus nicht lange vorgehalten haben. Im Alltag gingen viele der Veteranen sang- und klanglos gegen Qualifiziertere unter. Über Nacht waren aus Paradiesvögeln Sperlinge geworden. Aus gefeierten Helden die Handlanger jener, die sich pfiffig ums Heldentum gedrückt hatten. Um sich derweil im wirklichen Leben einen entscheidenden Vorsprung zu verschaffen.
Von Beginn an waren Tante und Onkel kein Traumpaar gewesen. Der heitere Herman war dieser attraktiven Frau weder in seiner affektiven, noch in seiner intellektuellen Bandbreite gewachsen. Was sich anfänglich und im zerstörten Berlin für die Tante sicherlich wie ein ordentlicher Gewinn angefühlt haben mochte, erwies sich zunehmend als Trostpreis. Der ziemlich schnell gänzlich aufgezehrt war. Sie hatte sich schlicht verrechnet. Vielleicht hätte sie die Rückkehr ins Europa der Fünfziger als Eingeständnis einer persönlichen Niederlage begriffen. Der letztmögliche Zeitpunkt, aus ihrem Spatzenkäfig zu fliehen, lag jedenfalls längst in der Vergangenheit. Das mochte sie in einer dunklen Stunde erkannt haben. Das Bewusstwerden dieser Unumkehrbarkeit wird ihr wohl endgültig den Boden unter den Füßen weggezogen haben.
Anstatt sich immerhin jetzt mit ihren Paradigmen auseinanderzusetzen, tat die Tante, was die meisten unglücklichen Menschen tun. Sie vermeiden die Konfrontation mit dem eigenen Gefühlsleben um jeden Preis. Und reiten sich mit ihrer Verweigerungshaltung weiter in die Scheiße. Im gestreckten Galopp. Finden weder Zugang zu ihrer Trauer, noch zu ihrer Verbitterung. Suchen die Ursachen für ihre Wut immer verbissener anderswo. Der Einfaltspinsel an ihrer Seite war sowieso an allem schuld. Die stumpfsinnigen schwarzen Kassiererinnen im Supermarkt waren so verantwortlich für ihren hilflosen Furor, wie die telefonische Warteschleife eines Reparaturservices, der die kaputte Waschmaschine reparieren sollte. Einer dieser raffgierigen Handwerksbetriebe, der offensichtlich ebenfalls nur „Neger“ beschäftigte. Einem solchen womöglich noch unterstand.
Wenn sie von ihrem täglichen Kampf gegen die grassierende Dummheit erzählte, fügte sie häufig an: „Ich übertreibe nicht, Jungs“. Wie um sich selbst zu beruhigen, dass sie sich keineswegs in etwas hineinsteigere. Wie viel liebevoller als mit Herman ging sie schon mit mir um, dem Fremden. Einem Zufälligen. Oliver war ihr Ein und Alles. Das letzte Bindeglied in ihre, einst so leichtherzig verschmähte Heimat. Der einzige Sohn ihres einzigen Bruders. Ich war Olivers Freund und gehörte gleichfalls zu jener Welt, die sie durch ihre Entscheidung so leichtsinnig von sich getan hatte. Hörte ihr aufmerksam zu und verstand zunehmend. Konnte irgendwann nicht mehr umhin, die Tante ins Herz zu schließen. Weil ich mich nicht mehr von ihren Worten beeindrucken ließ, sondern auf meine Einsicht hörte. Die Einsicht, dass da ein Mensch einfach keinen Zugang dazu finden konnte, sich selbst zu verzeihen.
Dieser erste Besuch am Mildred Place war aus einer Laune heraus geboren worden. Wie so vieles, wenn man Oliver und mich zusammen von der Kette ließ. Wir waren dem Alltag für ein paar Tage nach England entkommen, um ein paar Bälle zu schlagen, Freunde in Devon und Cornwall zu besuchen, oder warum auch immer. Wir mussten nie lange nach Gründen suchen, um auszukneifen. Ich war seinerzeit im Südwesten der Britischen Inseln aus verschiedenen Gründen noch bestens vernetzt.
Auf der Suche nach Geschenken fiel Oliver in einem Antiquitätenladen in Sidmouth eine Porzellanplatte in die Hände. Mit einem blauen Stempelabdruck gekreuzter Schwerter auf der Unterseite und sicher gute hundert Jahre alt. Ich hätte das gute Stück gar nicht bemerkt, aber Oliver fand sofort, diese Platte sei das perfekte Geschenk für die Tante in Amerika. Ein ausgemachter Schnapper zudem, wie der Geschäftsmann in ihm zufrieden anmerkte. Ich bemesse den Wert von Haushaltswaren eher an ihrem praktischen Nutzen. Die Schönheit der Formgebung einer Kaffeetasse entzieht sich meinem Stilgefühl. In meinem Geschirrschrank hat stets Platz gefunden, was mir im Laufe meines Lebens auf allen möglichen Wegen zukam. Manches neu und als persönliches Geschenk liebevoll ausgesucht und anderes, das anderswo nach ästhetischen oder praktischen Gesichtspunkten ersetzt wurde und sowieso übrig war.
Ein fachkundig zubereiteter Gemüseauflauf schmeckt einfach von jedem Teller zum Verwechseln ähnlich, wie ich finde. Den emotionalen Unterschied macht allenfalls der wärmende Gedanke an jene Person, die das benutzte Geschirrset allein für dich ausgesucht hat. Wie dem auch sei. Die Platte wurde unser. Womit gewissermaßen, es lässt sich denken, auch der Plan für deren baldige Übergabe in Gang gesetzt war. Schließlich schaute Weihnachten bereits um die Ecke. Noch am selben Tag telefonierte Oliver mit der Tante, ob es recht sei… Es sei ihr nicht nur recht, sie freue sich wie ein Kind, behauptete Tante Uschi.
Bereits am nächsten Tag checkten wir am frühen Nachmittag in Heathrow ein und landeten keine acht Stunden später auf JFK, wo uns ein hippeliger Herman erwartete. Er hatte sich längst zu sehr in sich selbst zurückgezogen, um noch gern Pfade zu gehen, die er nicht selbst getrampelt hatte. Seinerzeit kosteten Flüge von London an die Ostküste noch ein besseres Taschengeld. Ab 200 Mark pro Weg über den großen Teich, ohne nass zu werden. Wir investierten stets ein paar Mark mehr und flogen Singapore Airlines, Thai oder Cathay. Nur des einen Augenblicks wegen, wenn man von einer Stewardess sanft geweckt wurde. Aufschreckend in ein Lächeln blickte, das ein verständnisvoller Gott allein für diesen seligen Moment geschaffen haben mochte.
Ich erinnere mich noch genau, wie angefasst ich war, als wir in der Dämmerung in jenes Viertel einbogen, in dem Tante und Onkel lebten. Das war ein unglaublich abgefahrenes Gefühl. Krass surreal. Gewöhnlich verlässt du die Hauptstraßen nicht, um in einer Wohngegend rumzufahren. Machst dich höchstens verdächtig, wenn du außer Neugier dort mal gar nichts zu suchen hast. Zudem war ich vor Antritt der Reise kein Stück auf Amerika eingestellt gewesen. Hatte kaum Zeit gefunden, mich gebührend von den britischen Freunden zu verabschieden. Und fand ich mich, wenige Stunden später, am Set einer amerikanischen Vorabendserie wieder. Als seien wir Schauspieler, die von einer Szene in eine gänzlich andere gewechselt hatten. Die aus irgendeinem dramaturgischen Grund vorsah, in die Kulisse eines uramerikanischen Wohnviertels einzubiegen, um amerikanische Verwandschaft zu besuchen.
Zweitwagen haben regelmäßig in den Einfahrten vor den Garagen geparkt zu sein. Selten sieht man ein Auto am Straßenrand abgestellt. Über beinahe jedem Garagentor hängt ein Basketballkorb. Ganz wie in meinen Träumereien als Bub. Bloß die weißen Zäune scheinen verzichtbar. Einfriedungen sind überhaupt selten. Trotz der frühen Abendstunde ist kaum noch eine Seele unterwegs. Ein Junge auf einem Fahrrad ohne Heckgepäckträger, wie zufällig in die Szenerie geraten. Nicht mehr Kind und noch kein Halbwüchsiger. Er lässt sich sichtlich Zeit. Aber auch er folgt nur genauen Regieanweisungen, die im Moment vorsehen, dass er aus gutem Grund trödelt. Soll handlungsgemäß auf dem Heimweg sein. Ist noch ziemlich durcheinander, weil er dem hübschesten Mädchen der Welt eben den ersten Zungenkuss seines Lebens abgetrotzt hat. Der auch ihr erster war. Hatte überrascht festgestellt, dass sie sich überhaupt nicht bitten lassen musste.
Damit ist die böse Saat bereits gesät. Misstrauen und Eifersucht werden schon zwei Folgen später zum Zerwürfnis der Beiden führen. Er wird das Mädchen als Schlampe beschimpfen und sie wird weinen, weil sie nicht einmal begreifen kann, warum er sie plötzlich verachtet. Wird die Konventionen schnell von ihren kaltblütigeren Freundinnen lernen. Ein anständiges Mädchen hat sich zu zieren, bevor sie sich knutschen lässt. Selbst, wenn sie selbst noch so verliebt ist. Sie wird die Lektion begreifen und ihre Impulsivität gegenüber Jungen aufgeben. Wird ihr offenes Herz verschließen. Wird lernen, ihre Haut so teuer wie möglich zu verkaufen. Wie jedes ehrbare amerikanische Mädchen. Vorläufig aber sieht sie ihrem ersten Freund noch glücklich nach. Wie er ein bisschen Zeit schindet und selbst noch nichts von der Hässlichkeit seiner Ehrverletzung, zwei Folgen später, ahnt. Der trödelt wie einer, der sich wünscht, dass sich dieser magische Moment niemals verflüchtigen mag. Dessen Hochgefühl den hemdsärmeligen Pragmatismus seiner Sippe heute einfach nicht verträgt. Freilich müssen all diese Überlegungen Spekulation bleiben, weil wir weder Umschnitte noch Sichtweisen anderer Protagonisten mitbekommen. Wir bleiben bei uns und passieren einen älteren Komparsen, der vor der Haustür aufgestellt ist, um den milden Abend zu genießen. Er winkt uns zur Begrüßung zu. In Wirklichkeit winkt er natürlich nicht uns, sondern Hermans hellblauem Mustang. Den er am weißen Vinyldach und den billigsten Standardfelgen unter tausenden herauskennt. Eine einzigartige Konfiguration im Viertel.
In der Kühlschranktür wartete ein Orangensaft, wie es ihn, zumindest damals, nur in Amerika gab. Süß und süchtig machend. Weiß der Teufel, wie die ihren Orangensaft pimpen. Er schmeckt dort einfach – wie soll ich sagen – viel orangiger. Zeit für die nächste Szene. Und Action: Die Tante hat uns zu Ehren einen Festschmaus vorbereitet. Goldbraune Wedges, leuchtend grüne Tiefkühlerbsen und ein kiloschweres Porterhouse. Für jeden. Serviert auf ihrem Feiertagsgeschirr. Gekreuzte Schwerter auf der Unterseite der Tellerböden. Die, wie absichtslos, kurz ins Bild geraten. Nur ein weiteres Klischee aus der Folge: Amazed visitors. Wie auch immer. Das Steak hatte der gute Herman bei seinen früheren Kollegen organisiert. Für dieses himmlische Stück Fleisch hättest du jederzeit deine Beißer in Devonshire vergessen können.
Es muss um den 12. Dezember herum gewesen sein. Bei digitalen Bildern lassen sich alle nur denkbaren Daten auch noch nach Jahren exakt bestimmen. Aufnahmezeit und Standort, Belichtungszeit, Blende, Brennweite und so weiter. Bei Papierbildern schwierig bis unmöglich. Man hätte natürlich Buch führen können. Zu Zeiten analoger Fotografie gab es tatsächlich Fotografen, die jede denkbare Information zu jeder einzelnen Aufnahme gewissenhaft in einer Kladde oder auf Karteikärtchen vermerkten. Wie so viele Menschen versuchen, absolut jeden Aspekt ihres Lebens zu schablonisieren und strukturieren. Irgendwann geht halt unweigerlich das letzte bisschen Spontaneität in die Wicken.
Ich habe so viele Bilder gesehen, die technisch und kompositorisch verdammt nah an der Perfektion gewesen sind. Zum Neidischwerden nah dran. Wenn viele davon nur inhaltlich nicht so entsetzlich fad gewesen wären. Was ist beispielsweise an einem beschissenen Sonnenuntergang so großartig? Was ist derart spannend am millionsten Sonnenuntergang, dass du glaubst, du könnest keinesfalls darauf verzichten, ganze Fotoserien dafür rauszuballern, mein Freund? Nur weil digital nix kostet? Sonnenuntergänge am Meer. Im Hochgebirge. Hinter der großen Ebene, der Wüste, der Savanne und über dem Tannenwald. Jeden Urlaub derselbe Kack. So oft erlitten, so bemüht wunderschön, so dröge. Was ist los mit dir? Wirst du dieses Motivs eigentlich nie überdrüssig? Kannst du vielleicht mal irgendwann begreifen, dass die Sonne den ganzen Tag nur darauf wartet, Heerscharen von Amateurfotografen mit der immer gleichen Masche einzuwickeln? Sie macht sich für diese Momente sogar sichtbar fürs bloße Auge. Versuch mal, am hellen Tag in die Sonne zu kucken. Nach fünf Sekunden bist du tagelang blinder als jeder Maulwurf. Nach zwanzig Sekunden kannst du deine Augen direkt wegschmeißen. Das kriegt auch der fähigste Augenarzt nie wieder hin. Merkst du was?
Die Sonne kokettiert mittlerweile mit den Schaumkronen der Wellen und du hampelst herum, ob auch ja jede Einstellung für den großen Moment stimmt. Übersiehst einen, hinter deinem Rücken vorbeifliegenden, Pottwal. Verpasst dein allerbestes Foto. Das jedem Betrachter einen eigenen Roman erzählen könnte. Und vor dir lachen sich Sonne und Meer über deine Einfalt schlapp. Ziehen über dich her und im entscheidenden Moment womöglich sogar noch den Vorhang zu. In Form von ein paar idiotischen Schleierwölkchen am Horizont. Und du hast den World Press Photo Award für gar nichts verpasst. Nur weil du den hundertsten Augenblick mit nach Hause bringen wolltest, in dem ein scheinbar hinterfotziges Meer einmal mehr die vertrauende Sonne verschlingt. Komm zu dir, das ist alles nur ein billiger Trick. Die beiden stecken unter einer Decke. Das merkst du bloß nie, weil du auf der ständigen Hatz nach vermeintlicher Perfektion bist. Weil du im Bestreben, die eigenen Vorgaben im Kopf immer noch ein bisschen weiter zu expandieren, den Blick für die wirklich großen Momente verloren hast. Oh Mann, das regt mich gerade so dermaßen auf.
Um das Thema abzuschließen: Selbstredend ist es durchaus nicht von Schaden, auch die Technik ordentlich zu beherrschen. Sonst fummelst du nur stundenlang an den Einstellungen der Kamera rum. Und wenn du endlich zum Schuss bereit bist, ist das Leben längst weitergezogen. Auch deine einzigartigen Momente sind schließlich äußerst flüchtig, sonst wären sie ja keine Momente, sondern irgendeine längere Zeiteinheit. Erst durch einen Fotoapparat werden sie annähernd ewig und beliebig verfügbar. In deiner Imagination mag das Bild für alle Zeit mit einem magischen Moment verbunden sein. Für jeden anderen ist es eine mehr oder minder spannende Abbildung deines Moments. Ohne eigenen emotionalen Bezug. Wer jemals dem zweistündigen Diavortrag eines frischverliebten Pärchens über ihre erste gemeinsame Reise beiwohnen durfte, mag ahnen, wovon gerade die Rede ist.
Manche Labore stempelten immerhin schon damals das Datum auf die Rückseite jeder Aufnahme. Ich bewahre meine analogen Bilder in einer großen Kiste auf, die ich in einem sentimentalen Moment einmal liebevoll beklebt habe. Was das Finden bestimmter Erinnerungen allerdings kein bisschen erleichtert. Zwar bietet eine solche Wühlkiste keinerlei Systematik, fördert dafür mit jedem Griff Überraschendes zutage. Weil eine zwar akribisch vorbereitete, aber beinahe vergessene Saharatour Ende der Siebziger zufällig neben dem Schlaglicht auf ein Wochenende im Elsass zwanzig Jahre später zu liegen gekommen ist. An das man sich seltsamerweise viel öfter erinnert. Obwohl zwischen beiden Ereignissen keinerlei Zusammenhang zu bestehen scheint, so sind doch beides Momentaufnahmen aus ein und derselben Biographie. Schon gut. Ich habe ein bisschen den Faden verloren. Das alte Lied. Mangelnde Methodik.
Jedenfalls war es Mitte Dezember an der mittleren Ostküste gerade so mild, dass wir im T-Shirt am Ozean flanieren und auf ein bisschen Körperbräune hoffen konnten. Kameras blieben vorsichtshalber zuhause, damit wir Sonne und Meer unmöglich auf den Leim gehen konnten. Jones Beach ist keine halbe Stunde von Lynbrook entfernt. Ich wäre jeden Tag am Strand. War aber sowieso noch immer nicht wirklich angekommen. Ließ meinen Freund Oliver machen. Dieses war schließlich sein Amerika.
Als wir am frühen Abend und noch vor dem Sonnenuntergang vom Strand zurückkehrten, herrschte am Mildred Place fühlbar dicke Luft. Herman war wohl eingefallen, eine spontane Besorgung zu machen, als er bemerkte, dass er uns seinen Wagen geliehen hatte. Zwar hatten wir sowieso einen Leihwagen geplant, waren aber noch nicht dazu gekommen. Wenn du Downtown willst, ist ein Auto eher hinderlich, so dass wir den Mangel an individueller Mobilität die ersten zwei Tage gar nicht als solchen empfunden hatten. Verfügbare Parkplätze kosteten in Manhattan schon damals für drei Stunden gefühlt mehr als ein Neuwagen. Man fährt also mit der Long Island Railroad von East Rockaway oder Lynbrook an die Penn Station und bewegt sich in Bussen oder zu Fuß weiter. Das ist bequem und einigermaßen sicher. Kurz und gut. Die Tante nahm uns zur Seite und sagte wörtlich: „Nehmt euch doch einen Leihwagen Jungs und lasst Herman sein Auto. Und wenn er’s nur dafür braucht, wie ein Vollidiot stundenlang um den Block zu kurven“. Und wie auf Bestellung kichert Herman irre im Hintergrund. Da weißt du echt nicht mehr, ob du dich totlachen oder bestürzt sein sollst.
Zwei Stunden später stand ein silberner Lincoln am Straßenrand. Weil der Platz in der Einfahrt Herman zustand, der so gut wie nie in die Garage fuhr. Für den nächsten Tag waren heftige Schneestürme angesagt. Das Wetter kann an der Ostküste tatsächlich innerhalb weniger Stunden komplett drehen. Temperaturstürze von fünfundzwanzig, dreißig Grad sind durchaus keine Seltenheit. Wir hatten schon im Flieger ausgemacht, ins Lancaster County zu fahren, um den Amischen unsere Aufwartung zu machen. Um womöglich mehr vom Alltag dieser Menschen in Erfahrung zu bringen. Hofften, sie würden im Winter ein wenig zugänglicher sein, wenn sie nicht permanent wie Exoten in einem menschlichen Safaripark angestarrt würden. Diese Menschen unterwerfen sich auch ohne viel Worte jener entsagenden Lebensweise, von der eine knieweiche Betulichkeit hierzulande ihr halbes Leben nur schwärmerisch faselt.
Wenn man seine solideste Mannheimer Mundart herauskramte, konnte man sich recht brauchbar verständigen. Das Deutsch der Amischen ist Kurpfälzer Dialekten tatsächlich verblüffend ähnlich. Nur die Begriffe für alle Art Technik, die nach ihrem Exodus erfunden wurde, haben sie nachvollziehbar aus dem Englischen übernommen. Auch wenn sie die Errungenschaften der Neuzeit für ihren Weg der Einfachheit strikt ablehnen, so kennen sie selbstverständlich deren Bezeichnungen und ihre Bedeutung für die „Englischen“. Immerhin waren sie seinerzeit bei den vertrauten Tönen sogar ein wenig aufgetaut, wenngleich sie ansonsten den Englischen, also allen Nicht-Amischen, eher aus dem Weg gehen. Sie bevorzugen es, unter sich zu bleiben, um der Sünde gar nicht erst Gelegenheit zu geben, durch einen nachlässigen Türspalt in ihre Welt zu schlüpfen. Leben noch immer kaum anders, als ihre Vorfahren. Ohne Strom und all dem Teufelszeug, das sich damit betreiben lässt. Die meisten Amischen haben gute und offene Gesichter. Kleinere Kinder tragen im Sommer oft nicht einmal Schuhe. Dafür stets lustige Strohhütchen gegen die Sonne.
Der Sommer konnte freilich kaum weiter weg sein. Angesichts der angekündigten Großwetterlage wäre ich sogar bereit gewesen, die Fahrt zu verschieben, aber Oliver rieb sich bereits die Fäustchen. So man bei einem Zweimetermann überhaupt von Fäustchen reden kann. Jede Einrede wäre auf taube Ohren gestoßen. In dieser Beziehung war mein Freund womöglich noch wahnsinniger als ich selbst. Ein richtiger Katastrophentourist.
Wenn Oliver und ich unterwegs waren, wurde meist Kindheit nachgeholt. Nicht selten in verschärfter Form. So trieben wir uns einmal in Frankfurt herum, warum ist mir entfallen. Waren beide längst selbständig, Ende zwanzig oder so. Hatten Angestellte und hätten uns so viel Kurzweil kaufen können, wie uns eingefallen wäre. Wer will allerdings haben, was er leicht kaufen kann? Einer von beiden kam auf die unselige Idee, ein paar ausrangierte und abgestellte Waggons auf einem Bahngelände in Griesheim zu inspizieren.
Wobei ich ausdrücklich betonen möchte, dass wir niemals etwas kaputtgemacht oder mit Tags zugesprayt hätten. Jenes leidige Sprayen, das für Uneingeweihte nichts als unerfreuliche Sachbeschädigung – und auch wenig ästhetisch ist, war seinerzeit längst nicht so verbreitet wie heute. Wir waren einfach endlos versessen auf alles, was nur ansatzweise nach Abenteuer roch. Mussten in diesem Fall über einen Zaun, auf unzweideutig privates Terrain also. Nach meiner Lebenserfahrung werden Abenteuer in den meisten Fällen erst durch Einfriedungen überhaupt abenteuerlich. Wir fanden eine unverschlossene Tür an einem Waggon und enterten. Verzehrten eine mitgebrachte Brotzeit und vertrödelten eine halbe Stunde.
Wie wir gerade einen ausgemusterten Speisewagen genauer unter die Lupe nehmen, gehen draußen zwei Sicherheitsleute mit ihrem Schäferhund vorbei. Die Töle wittert uns, stellt die Lauscher wie Richtantennen und schlägt an. Wir auf der anderen Seite raus und über die Gleise davon. Die Sicherheitsleute machten einen eher apathischen Eindruck und wären schon aus aerodynamischen Gründen als Gefahrenmoment vernachlässigbar gewesen. Außerdem mussten sie erst um den Zug herum. Nicht so ihr leichtfüßigerer Köter. Der losgelassen sogleich die, gar nicht dumme, Direttissima unter dem Zug weg wählte. Wir schafften es mit Ach und Krach über ein Tor. Ich zog so eben das zweite Bein rüber, als ich das Gebiss unter mir schnappen hörte.
Natürlich hätte man die Kontrolle gemütlich abwarten und die Sache mit ein paar Mark aus der Welt schaffen können. Ein bisschen zerknirschtes Gesicht, die Uniformierten ihre Besserwisserei genießen lassen. Kleine Brötchen gebacken und dem Gegenüber wie absichtslos einen Zwanni in die Brusttasche geschoben. Schließlich sind solche Jobs chronisch unterbezahlt. Hätten wir wahrscheinlich sogar gemacht, wenn wir im ersten Schreckmoment auch die erweiterten Möglichkeiten des Hundes bedacht hätten. Wenn aber einer losflitzt, weil es brenzelt, dann rennst du mit. Besonders, wenn du dich jener Maulschelle für Ball in Scheibe erinnerst, als du im sicheren Bewusstsein deiner Unschuld einmal nicht mitgerannt bist. Kurz und gut, mit einem investierten Schein wäre dieses Abenteuerchen erst gar nicht zu einem solchen geworden.
Irgendwann tauchte Oliver mit seiner ersten S-Klasse auf. Stolz wie Oskar in einer neuen Tonne. Ein langer 280er mit Vollausstattung. Baureihe 126. Nagelneu. Schwanenhalsradio von Blaupunkt. Vor allem: Autotelefon. Platzräubernd wie ein Volksempfänger. Nichts weniger als der allerletzte Schrei. Das Hallo der Neidlosen war ihm so gewiss, wie das Gezischel der Missgünstigen. Auch die Klimaautomatik war ein Novum für uns alle. Ich hatte zwar schon den einen oder anderen Amischinken hinter mir, der sowas ab Werk und in der Theorie eingebaut hatte. Das waren allerdings durch die Bank eher runtergerockte Gurken, bei denen sich vielleicht noch die Räder problemlos drehten, aber der Klimakompressor schon lange nicht mehr. Wobei ich Klimaanlagen in Autos seit je für entbehrlich gehalten habe, wo’s meist schon runtergeleierte Scheiben auch tun. Oliver behauptete jedenfalls, man könne die Kälte gar nicht ertragen, wenn man auf Grabeskälte stellte. Michael, der zufällig bei uns stand, interessierte die Sache genauso wie mich. So saßen wir ein paar Tage später im Juli zu dritt in Winterjacken und Pudelmützen in Olivers Nobelkarre und testeten, was zu testen geboten war. Michael war vor Andacht oder Bibbern verstummt und auch ich musste anerkennen, dass die künstliche Temperatur nach unten zumindest in einem Auto wohl schwer zu toppen sei. Wenngleich es immerhin die Pudelmützen nicht gebraucht hätte.
Ein andermal brachte ich die Hinterreifen seiner nagelneuen E-Klasse zum Pfeifen, weil Oliver im Brustton der Überzeugung in den Raum stellte, die neuartige Antischlupfregelung ließe sich keinesfalls überlisten. Sie ließ durchaus. Probier es selbst, wenn du glaubst, ein passabler Autofahrer zu sein. Kickdown im Scheitelpunkt einer Haarnadelkurve und mit entsprechend Dampf überholt dich der eigene Arsch schneller, als du „Apfeltasche“ oder einen anderen Viersilber sagen kannst. Unter der beweisführenden Begleitmusik der Pneus selbstverständlich. Die Karre ist von deiner unerwarteten Anforderung im heikelsten Moment völlig überfordert. Oder so überrascht, dass sie glatt vergisst, die Antriebsräder zu regulieren. Weil du selbst auf das Ausbrechen selbstverständlich gefasst bist, ist die Attacke auf dein Reaktionsvermögen auch mit Gegenverkehr nur halb so wild. Alles im Griff. Im Ernst? Die Chaise hatte an die 80.000 Eier gekostet. Alles in allem ein bisschen viel Risiko, nur um den Nachweis zu erbringen, dass Technik selten perfekt ist. Aber was soll ich heute noch über solche Torheiten lamentieren. Lief diese Geschichte doch kein bisschen anders, als von mir vorhergesehen.
Im Winter warteten wir einmal wochenlang auf einen Sturm, weil sich Oliver in den Kopf gesetzt hatte, am eigenen Leib zu erleben, wie sich sowas auf einem Schiff anfühlt. Die Vorgabe lag bei zehn Beaufort Minimum. Ein paar Tage nach Weihnachten tat uns ein Tief den Gefallen. Um fünf in der Frühe gings los. In vier Stunden waren wir an der belgischen Küste. Seinerzeit war das noch leicht zu schaffen. Einchecken. Weitere vier Stunden zwischen Ostende und Dover. Mit derselben Fähre direkt retour. Lange vor Mitternacht waren wir wieder zu Hause. Dazwischen hatte ich mehr grünliche Gesichter beieinander gesehen, als in meinem ganzen Leben zuvor. Der Kapitän fand sich offenbar auch als Alleinunterhalter super. Begleitete das jämmerliche Konzert für hundert Tüten mit launigen Sprüchen über den Bordlautsprecher. Der Weg an Deck war versperrt. Zu gefährlich. Du kannst nicht immer alles haben.
Zwei Jahre später erlebte ich im Dezember zwischen Plymouth und Roscoff einen ausgewachsenen Orkan. Befand mich diesmal viel näher am offenen Ozean, als im Nadelöhr des Ärmelkanals. Ein wunderbares und überaus empfehlenswertes Abenteuer, solange Seekrankheit ein Fremdwort bleibt. Und nicht die Angst von einem Besitz ergreift, das Schiff könne mit den turmhohen Wellen nur ein einziges Mal nicht fertig werden. Dieser Kapitän besaß mehr Takt. Hielt sein Kapitänsmaul und kümmerte sich um den Kurs der Fähre. Neben vielen sehr grünen Gesichtern sah ich auf dieser Überfahrt nämlich auch erstmalig, wie sich blanke Todesangst in menschlichen Gesichtern ausmacht.
Ich könnte viele Geschichten aus unserer wunderbaren Freundschaft rauskramen. Irgendwann rannten wir im Bewusstsein ihrer Krisenfestigkeit genau in den Fehler, den Freunde keinesfalls machen sollten. Wir taten uns für ein Geschäft zusammen, das dann tatsächlich in die Hose ging. Die Rahmenbedingungen waren einfach gegen uns. Er hätte es wissen können und ich hatte meine unternehmerischen Fähigkeiten überschätzt. Mehr ist dazu nicht mehr zu sagen. Scheiß auf die Kohle, aber das Vertrauen war wohl ramponiert.
Für mich war Geld nie mehr als Mittel zum Zweck. Verfügte ich über reichliche Mittel, gab ich es mit beiden Händen aus. Hatte ich wenig, suchte ich mir eben preiswertere Zerstreuung. Ich nutzte die Bruchlandung, löste emotionslos auch die letzten ungeliebten Reste meiner beruflichen Verpflichtungen auf und empfahl mich nach Krakau. Wo ich immer schon mal in den Tag leben wollte. Ein paar Groszy lassen sich schließlich an jeder Weltecke schnappen. Während ich nun allein in verlassenen Fabrikhallen, Kliniken und Hotels weit im Osten herumkroch, um Fotomotive zu finden, dachte ich manchmal an unsere gemeinsamen Erkundungen und Versuche. Vielleicht hätte Oliver meine neue Welt auch ganz gut gefallen.
Früh am nächsten Morgen hatte es tatsächlich zu schneien begonnen. Wir verließen Long Island gegen zehn in der Frühe in Richtung Pennsylvania. Hinter Allentown war das Schneetreiben merklich dichter geworden. Obwohl die Fahrbahn längst mit einer geschlossenen Schneedecke überzogen war, blieb der Tempomat auf sture sechzig Meilen eingestellt. Die äußere linke Spur wird bei Schneefall ohnehin nur von Trucks befahren. Die ebenfalls ihre gewohnte Geschwindigkeit beibehalten. PKWs kriechen auf der rechten Spur schön aufgereiht hinter dem Vorsichtigsten her. Kommen gar nicht auf die Idee, schneller zu fahren. Der Leader wird schon wissen, was er tut. So ist das in den Staaten. Die Leute fühlen sich selbst dann aufgehoben, wenn sie sich dem allerletzten Blödmann anvertraut haben. Ich hatte auch stets den Eindruck, als ob amerikanische Autofahrer von Wetterkapriolen womöglich noch leichter zu überraschen und beeindrucken sind, als Europäer. Ich vermute mal, dass sie durch wesentlich niedrige Reisegeschwindigkeiten unter Normalbedingungen einfach gewohnt sind, sich wie Sardine in Sardinenschwarm mitführen zu lassen. Stundenlang in eine Richtung manchmal. Kommen schnell durcheinander, wenn einer tatsächlich mal gegen den Strom schwimmt.
Andererseits verlierst du in diesen Dickschiffen tatsächlich leichter deine Sensibilität für reale Gefahr. Draußen macht es richtig runter und du sitzt gemütlich wie in deinem Ohrensessel. Aus dem Radio dudelt James Taylor. „Shower the people“. Die Dixie Chicks, Natalie Cole oder James Brown. Je nach Format. In den USA bleiben Sender gern bei einer Musikrichtung, schon wegen der Werbeblöcke. Hillbillys kaufen nun mal andere Produkte als Leute, die R&B oder House hören. Eigentlich fehlte nur noch ein offener Kamin und ein Gläschen Barolo. Fatale Fehleinschätzung, Freundchen. Das Wetter ist nämlich überall und du schwimmst gerade mitten durch diese eisige Suppe.
Oliver schien auch ohne Not jederzeit Zeitdruck zu verspüren. Man konnte den Eindruck gewinnen, dass er einem inneren Terminplan folgte, der von einer Art verzweifelter Lebensgier diktiert wurde. Den er unbedingt einzuhalten hatte. Beim Vorwärtskommen zählte nur Effektivität. Selbstbestätigende Raserei war ihm völlig fremd. Nie hätte er sich auf ein Rennen mit Zufälligen eingelassen. Solche Kinkerlitzchen vergeuden nur eigene Zeit. Dergleichen soll Autofahrern vorbehalten bleiben, die sich über ihre Vehikel identifizieren müssen, anstatt sie funktionell zu nutzen. Er saß auch nicht gern auf dem Beifahrersitz. Wurde immer ein bisschen zappelig, wenn man mit einem zu beiläufigen Fahrstil Zeit verplemperte. Einen gemeinsamen Freund quengelte er einmal in dessen eigenem Wagen auf den Beifahrersitz. Er ertrug dessen redselige Trödelei einfach nicht mehr.
Mir war Olivers kapitale Kompromisslosigkeit in diesen Dingen immer recht. Als Beifahrer konnte ich leicht abschalten, die Landschaft auf meine Art betrachten und meinen Gedanken nachhängen. Kam trotzdem immer in der denkbar kürzesten Zeit ans Ziel. Ich könnte mich nicht erinnern, auch nur einmal Bedenken, ob seiner effizienten Fahrweise gehabt zu haben. Warum auch? Er schien jederzeit Herr der Lage und erfahrungsgemäß erwischt es sowieso immer andere. Und schließlich wollten wir noch was vom Tag haben. Sahen spannenden Begegnungen entgegen.
Ich meine mich zu erinnern, dass wir unseren Bestimmungsort selbst an diesem Tag, trotz aller witterungsbedingten Widrigkeiten, noch immer innerhalb des angepeilten Zeitfensters erreichten. Unser erstes Ziel wäre der Farmers Market von Bird-in-Hand gewesen. Die Enttäuschung eigentlich vorhersehbar. Die Farmer blieben bei diesem Wetter zu Hause, der Markt fiel aus. Die Amischen sind entweder zu Fuß oder mit Pferdekutschen unterwegs. Ihre Kinder seltener einmal mit Tretrollern, am Straßenrand lang. Fahrräder beinhalten vermutlich bereits zu viel Technik.
In dieser Weltecke darf man schon der unterschiedlich schnellen- und stabilen Fortbewegungsmittel wegen generell nur sehr langsam fahren. Bei meinem ersten Besuch in einem Sommer überholte mich mal ein Sulky. Der Fahrer, ein junger Amischer, hatte sichtlich Spaß und ließ es entsprechend krachen. Bei den Familienkutschen handelt es sich um beinahe quadratische dunkelgraue oder schwarze Kästen, die auf ein Fahrgestell aus Metall aufgeschraubt sind. Keine Luftbereifung, sondern Eisenbänder um die Felgen. Gottesfurcht meint bei diesen Menschen immer auch Entsagung. Mich erinnern diese Wagen auch ein bisschen an Leichenkarren oder etwas ähnlich Schwermütiges.
Nichts weniger sind sie leicht gebaut und bei einem Zusammenstoß sicherlich entsprechend zerbrechlich. Ich nehme an, der Aufbau besteht hauptsächlich aus Sperrholz, Tischlerplatten oder einem leichten Vollholz. In der heutigen Zeit vielleicht sogar aus Fiberglas, Alu oder etwas in der Art. Ich habe aber keine Idee, ob Kunststoffe oder Metallverbindungen überhaupt erlaubt sind. Jedenfalls muss das Material stabil, dauerhaft und, vor allem, leicht sein. Ob da tatsächlich noch nie einer auf die Idee gekommen ist, seine Karre mit Applikationen von Mooreiche oder Sequoia zu pimpen? Mit einer Innenausstattung aus plüschigen Fauteuils und hübsch geschwungenen Haltegriffen und Türöffnern aus Messing womöglich. Um sich vor den Nachbarn halbstark aufblähen zu können, wie es in beinahe allen Gesellschaften gang und gäbe ist?
Ganz falsch. Diese Wäggli haben Funktion zu erfüllen und taugen nicht zum Statussymbol. Prahlerei ist in dieser Gemeinschaft nicht nur unerwünscht, sondern nachgerade frevlerisch. Und Komfort in Kutsche nicht weniger verpönt als Kissen auf Kniebank. Vor allem achten die Amischen ihre Tiere, wie es das Neue Testament vorschreibt. Welchem Rösslein willst du denn als Gottesfürchtiger zumuten, zusätzlich zum Eigengewicht des Wagens und der Passagiere ständig eine halbe Tonne Mobiliar und Zierrat durch die Botanik zu zerren? Warum vor allem sollte sich auch nur ein Bedürfnisloser bei diesem Wetter dem Risiko aussetzen, wegen ein paar Dollar mitsamt Pferd und Wägelchen vom übermüdeten Fahrer eines Fünfachsers eingeebnet zu werden?
Wir hatten kein sicheres Obdach. Sahen uns infolgedessen banaleren Problemen gegenüber. Fanden schließlich ein Schnellrestaurant, in dem sich außer uns nur eine Kellnerin aufhielt. Mochten auch noch keine halbe Stunde gesessen haben, als es draußen richtig abging. Einen Blizzard kann man sich nicht vorstellen. Man muss ihn erleben. Als seien physikalische Gesetze außer Kraft. Grundrichtungen beliebig geworden. Farben zerfließen zu einigen wenigen Grauschattierungen. Sichtweite vernachlässigbar. Der Schnee folgt nicht mehr den Naturgesetzen und fällt ordnungsgemäß von oben nach unten, sondern peitscht von überallher auf das ungeschützte Gesicht ein und macht die Augen schmerzen. Stäubt durch jede Ritze in Fenstern oder Türen, bis weit in den Raum.
Sah so der Weltuntergang aus? Die propere Brünette hinter dem Tresen mochte ähnliche Befürchtungen hegen. Auf den ersten Blick hatte sie einiges jünger ausgesehen. Jedesmal, wenn ihr das Licht mitleidlos ins Gesicht schien, konnte man allerdings sehen, dass der Lack schon ein bisschen mitgenommen war. Außerdem sah sie zu oft und zu hungrig zu uns hinüber, um sich ihres eigenen Auftritts wirklich sicher zu sein. Fand womöglich Gefallen an dem Gedanken, dass sie gerade zwei Spinner bewirtete, die offenbar verrückt genug waren, dem Teufel bei jedem Wetter auf den Schwanz zu treten. Konnte sich vielleicht sogar vormachen, die Beiden hätten sich nur deshalb auf den Weg gemacht, um die letzten Stunden dieser Welt mit ihr zu teilen.
Aber ich fabuliere mal wieder. Wahrscheinlicher rechnete sie sich einfach ihre Überstunden aus, wenn der Sturm drei oder gar vier Tage anhielte. Vielleicht hatte sie tatsächlich einen eigenen Weg gefunden, die Relativitätstheorie mithilfe der Krümmung von Donuts zu beweisen. Dachte am Ende gar darüber nach, den tyrannischen Ehemann zu ermorden, um für ihre Geliebte Platz zu schaffen. Immerhin befanden wir uns in der Heimat der Dramaqueens. Der steten Banalisierung des Bösen. Wie auch immer. Tatsächlich können wir nur Spekulationen anstellen, welche Filme unter dem kastanienbraunen Scheitel einer amerikanischen Serviererin inmitten einer Naturkatastrophe gespielt werden. Oliver war mit Rührei und Toast beschäftigt. Ich unterzog die Eckbank einer eingehenden Inspektion, weil ich mich langsam darauf einstellte, mindestens die kommende Nacht in diesem Diner verbringen zu müssen.
Einige Stunden später ließ das Gestöber überraschend nach. Apokalypse vorläufig ausgesetzt. Die Kellnerin konnte die, im Kopf wahrscheinlich schon dreimal verplemperte, Überstundenknete jedenfalls wieder vergessen. Oliver hatte sich um Proviant gekümmert und wohl schon beim Rührei entschieden, noch heute Land zu gewinnen. Mir war es recht. Auf was hätten wir auch warten sollen? Das gesellschaftliche Leben würde sich so schnell nicht wieder normalisieren. Wir räumten geschätzte dreißig Zentimeter Schnee vom Auto. Es war längst dunkel, als wir diese archaische Welt verließen, die uns noch nicht mal einen Blick auf ihre Fassade zugestanden hatte. Selbst die Kellnerin war weder Amische noch Mennonitin, sondern zweifellos eine „Englische“ gewesen. Die News hatten Räumfahrzeuge auf dem Pennsylvania Turnpike gezeigt. Diesen zu erreichen musste also das erste Ziel auf dem Weg zurück zur Küste sein. Da und dort hatte der Wind die Fahrbahn bereits wieder blank gefegt. Die abgetragenen Schneemengen an anderen Stellen zu Schneezungen und Verwehungen aufgetürmt.
Was folgte, war die wohl denkwürdigste Autofahrt im Winter, derer ich mich besinnen kann. Vielleicht meine allerdenkwürdigste überhaupt.
Teil 4 folgt