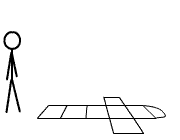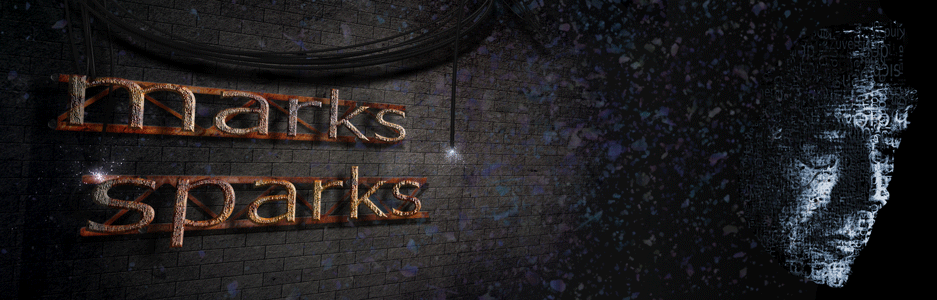Als Katrin plötzlich ganz viele Geschenke bekam
In Berlin stellt heuer eine knappe Hälfte der Eltern Anträge auf Grundschulwechsel. Hab ich aus den Nachrichten. Knapp die Hälfte ist nun allerdings sehr sportlich. Erwartungsgemäß begeben sich die Redakteure der meisten Gazetten sogleich politisch korrekt auf Ursachensuche. Formulieren mit wohlgesetzten Worten um den heißen Brei, nennen die hässliche Kröte lieber nicht beim Namen. Immerhin kommt der Tagespiegel ohne viel Umschweife auf den Punkt.
Dort heißt es: „Vor einigen Jahren hatte der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration eine Studie in Auftrag gegeben, um die Gründe und die Auswirkungen der Flucht aus der Kiezschule zu erfassen. Dabei wurde die Vermutung bestätigt, dass bildungsinteressierte Eltern die Schulwahl stark vom Migrantenanteil abhängig machen, weil sie befürchten, dass ihre Kinder an Schulen mit vielen sozial benachteiligten Zuwanderern weniger lernen.“ Das lassen wir vorläufig mal so beziehungslos stehen.
Kleinbürgers Rassismus tobt sich vorzugsweise unter Gleichgesinnten aus. Auf unbekanntem Terrain wird das Thema gern mit der Floskel „ich bin sicher kein Rassist, aber….“ eröffnet. Einem schafspelzigen Opener für xenophobe Wölfchen. Die Hohlräume des WorldWideWeb erweisen sich als ideale Dunkelkammern für die Entwicklung fremdenfeindlichen Gedankenguts. Schon wer sich die Kommentarspalten der Netzausgaben bürgerlicher Gazetten antut, ahnt, in welch hermetischer Blase sich viele mittlerweile gegen jede humane Logik abgeschottet haben. Sich nur im einträchtigen Dünkel gegen vermeintlich Minderwertigere wertig fühlen können. Seitenlang dieselbe Leier, ein epidemisch hilfloses Hassgestammel.
Nun ist dieser ganze ethnozentrische Zinnober hinlänglich beleuchtet und just das, was sich Gesellschaft gemeinhin unter Rassismus vorstellt. Wofür einmal mehr wiederkäuen, woran sich eine beflissene Journaille tagtäglich abarbeitet? Ich verzichte an dieser Stelle darauf, auf Affenlaute aus der Fankurve, Pöbeleien, gewaltsame Übergriffe und ähnlich tumbe Ausprägungen einzugehen. Mölln, Solingen und Hanau bedürfen erst recht keiner weiteren Bewertung. Zu dergleichen Widerwärtigkeiten darf es einfach keine zwei Meinungen geben.
So unbeirrt dieser Rassismus Gewalt gegen Menschen anderer Hautfarbe und/oder Herkunft bagatellisiert, akzeptiert, goutiert oder gar forciert, so selbstverständlich werden Demos oder Fackelzüge für das autochthone Opfer gewalttätiger Migranten inszeniert. Die, bezüglich Art und Auftreten, unstreitig unangenehmste Bilder assoziieren. Hier werfen die Teilnehmer eher mit furchterregenden Blicken um sich, lassen ansonsten alle Welt unüberhörbar an ihren völkischen Flatulenzen teilhaben.
Dass die, immer wieder gedankenlos als „Ehrenmorde“ nachgeplapperten, Femizide nur von den ganz Krassen begangen werden, steht doch außer Diskussion. Genauso zweifelsfrei lässt sich jeder einzelne der Täter aber auch einer definierbaren Zuwanderergruppe zuordnen. In unserem Kulturkreis meuchelt Brüderchen sein Schwesterchen nun mal nicht, weil die junge Frau lieber mit ihrem Märchenprinzen zusammen sein will, als mit dem Dödel, den ihr Erzeuger für sie ausgekungelt hat. Schon, weil hier längst kein gesunder Mensch mehr auf die dämliche Idee kommt, die Familienehre zwischen den Schenkeln seiner weiblichen Familienmitglieder zu vermuten. Das Frauenbild, welches die, häufig in konservativ-islamischen Männergesellschaften sozialisierten, Bürschlein im Gepäck haben, ist mit sexueller Selbstbestimmung schlicht nicht vereinbar.
Die organisierten Übergriffe Silvester 2015 auf der Kölner Domplatte und weiteren Tatorten waren so sexistisch wie rassistisch motiviert. So man die unerträglichen Zwillinge überhaupt voneinander trennen kann. Erniedrigst du die Frauen, dominierst du ihre Gesellschaft – eine so simple, wie menschenverachtende Gleichung. Die Matrize lieferten die Gewaltexzesse gegen demonstrierende Frauen auf dem Kairoer Tahrir Platz nach dem Sturz Mubaraks. Eine notwendige gesellschaftliche Debatte wurde allerdings aus Gründen der politischen Hygiene ziemlich plump abgewürgt. Weil nach geltender Lesart gar nicht passiert sein konnte, was nicht passieren durfte.
Eine derart tief verwurzelte Aversion gegen tolerantere Gesellschaftsformen – vor allem gegen selbstbestimmte Frauen – geht aber nun mal nicht einfach weg, indem wir hingebungsvoll Willkommensplakate pinseln oder gut gemeinte Integrationskurse aufs Auge drücken. Die, solange nicht konsequenzbehaftet verpflichtend, ohnedies nur von Integrationswilligen besucht werden. Es hilft auch wenig, sich das Gute ganz feste herbeizuwünschen. Übergriffe werden kein bisschen verständlicher, wenn jede kritische Haltung zu einer praktisch regellosen Zuwanderung reflexartig ins rassistenverdächtige Abseits bugsiert wird. Oder so relativiert: „Unsere sind ja auch nicht ohne“. Noch simpler: „Sind ja nicht alle so“. Was willst du auf sowas erwidern, ohne unhöflich zu werden? „Vielen lieben Dank für Deine überaus erhellenden Informationen. Das wusste ich ja echt noch nicht… macht natürlich alles gleich viel erträglicher… ähähähä?“ Macht es Gewalt gegen Frauen auch nur ein Quäntchen akzeptabler, weil die Gesellschaft schließlich auch mit weißdeutschen Frauenhassern leben muss? Muss sie tatsächlich? Oder reichen die am Ende noch nicht?
Auslöser und Motivation sind hier wie da Minderwertigkeitskomplexe und deren (vermeintliche) Kompensation. Immer wieder herrenmenschliche Hybris. Davon abgesehen ist relativierende „Argumentation“ grundsätzlich aus der gleichen Schublade, die sogleich zuverlässig mit einem Potpourri von Gräueltaten der Alliierten aufwarten kann, sobald von Kriegsverbrechen der SS oder Wehrmacht die Rede ist. Totschlagargumente würdigen nicht nur die Opfer herab, sie geringschätzen auch die Integrität von Mitdiskutanten jeden Alters und Geschlechts – und zwar fundamental. An dieser Stelle muss allerdings auch gefragt werden, was es über die Männer einer Zivilgesellschaft aussagt, die zumindest in besagter Nacht offenbar nicht willens- oder in der Lage waren, ihre Frauen situativ angemessen vor systematisch sexualisierter Gewalt zu schützen. Vielleicht ist der Tag gar nicht mehr so fern, an dem sich dieser Gesellschaft generell die Frage stellt, wessen Schutz Priorität genießen muss – unabhängig von humanitären Gemütswallungen und politischer Orientierung. Anders gesagt: selbst dem Allergutesten wird vermutlich irgendwann die Puste ausgehen.
****
Wie snobistisch ist eigentlich eine Logik, die immerhin den Schluss zulässt, man dürfe importierten Schafsköpfen ihre Ausfälle nicht ganz so krumm nehmen? Weil Traumata nach Verständnis und Integration nach Geduld verlangten und es für manche eben nicht einfach sei, sich in lokale Gepflogenheiten einzufinden. Überhaupt gebe auch ja auch unter Einheimischen reichlich reaktionäre Hornochsen. Geht’s eigentlich noch? Ich hatte selbst das Privileg, teilweise Jahre in anderen Weltgegenden verbringen zu dürfen. Mit welchem Recht hätte ich dort ständig vernehmbar rumnölen können, als wisse ich schon kraft gesegneter Herkunft besser, wie der Hase zu laufen hat? Zu erwarten, dass sich die jeweiligen Gast- oder auch Arbeitgeber gefälligst auf meine Neigungen und Gewohnheiten einzustellen haben? Mich komplett daneben zu benehmen, weil andere Kulturen und Denkweisen keinen Respekt verdienen?
Was ich suchte, waren vielmehr neue – oder veränderte Perspektiven. Grundlegendes bemerkst du bald, Nuancen nur, wenn du wirklich achtsam bist und eintauchst. Indem ich beobachtete und bereit war, möglichst wie Pawel in Polen zu leben, wie Dave in Devon oder wie Yagmur dort, wo urlaubsreife Menschen eigentlich keinen Regen mögen, stellten sich unausbleiblich Bekanntschaften ein, aus denen auch manch andauernde Freundschaft erwuchs. Bei einigen wurde ich vielleicht zu Marek, oder Markos, blieb aber bei allem Zugewinn immer ich selbst – oder was ich dafür halten kann.
In Krakau lernte ich schnell, die angesagten Viertel an Wochenenden großräumig zu umgehen, weil Freitagabends regelmäßig Europas „Eventtouristen“ in Billigfliegern einfallen, um für zwei Tage und Nächte richtig die Sau rauszulassen. Halbstarke in Rotten müssen sich anderswo wohl einfach wie Eroberer aufführen, um sich als richtige Männer zu fühlen. Insofern sollte eine Gesellschaft sowohl das freiwillige Gast- als auch das verbriefte Asylrecht keinesfalls als Einbahnstraße anbieten. Vielmehr solltest du von Beginn an unmissverständlich Respekt vor eigenen Traditionen und kulturellen Limits einfordern – selbst, wenn diese den Gast noch so sehr in seinen Anschauungen verunsichern – oder seinen Tatendrang ausbremsen mögen. Wenn er damit nicht klarkommt, könntest du dich immer wieder bereitwillig an Korrekturen am eigenen Wertesystem versuchen. Du kannst es aber geradesogut lassen, denn es wird ohnehin nie genug Entgegenkommens sein.
Von daher vermag ich keine Sekunde einzusehen, weswegen „unser Zusammenleben täglich neu ausgehandelt werden müsse“. Niemand ist doch gezwungen, die tradierte Lebensweise der Menschen seiner Wahlheimat zu ertragen. Ist die Welt denn nicht so viel größer? Hat sich eine Frau Özoğuz eigentlich je gefragt, warum das von ihr gewünschte „Aushandeln“ nicht mal bei ihren eigenen Brüdern gelingt? Das sind unversöhnliche Hassprediger, die so gar keinen Bock auf Kompromisse haben. Die wollen nichts weniger als die Scharia und die eigene Weltanschauung durchsetzen. Bei dieser setzt es bereits Prügel, wenn das Kopftuch unziemlich verrutscht. Da heißt’s auch schon mal Rübe runter, wenn du deine eigene Meinung allzu vorlaut vertrittst.
Was stimmt eigentlich überhaupt noch bei einer Partei, die nun schon seit Jahrzehnten zähneknirschend als „das kleinere Übel“ gewählt wird. Ein permanenter Minimalanspruch muss doch irgendwann das Selbstverständnis aushöhlen. Kann fast nur satt und überheblich machen. Vor allem: Was sagt das denn über unsere eigenen Ansprüche an Qualität und Niveau aus? Was soll dabei rauskommen, wenn wir längst als normal empfinden, dass sich offensichtlich nie die Vortrefflichsten zur Wahl stellen, sondern bestenfalls blasierte Drittklassigkeit?
Zum Beispiel das: Der kleine dicke Vizekönig Sigmar darf auf einem ostdeutschen Marktplatz, wohlverschanzt hinter seinen Personenschützern, seinen kleinen dicken Stinkefinger gegen Asylgegner und rechtsextreme Radaubrüder ausfahren. Der traut sich ja was. In einem anschließenden Fernsehinterview bezeichnete er die Demonstranten ausnahmslos als „Pack, das eingesperrt werden muss“ – und weiter: „Diese Leute haben mit dem Land Deutschland, wie wir es wollen, nichts zu tun“. Ist mir tatsächlich was entgangen? Sind wir schon wieder soweit? Schönen Gruß vom Reichspropagandaminister. Der Klumpfuß hat vor Vergnügen vermutlich ein Loch in den Höllenboden gestampft.
Die verbale Verrohung auch von Spitzenpolitikern, ihr angeödetes Nicht-wirklich-Zuhören, das ignorante Nie-drüber-Nachdenken, ein arrogantes Angewidert-Sein von der panischen Angst der kleinen Frau und ihres kleinen Mannes vor Überfremdung. In deren Quartieren die Zuwanderer erfahrungsgemäß nun mal landen. Ist es nicht just diese Abgehobenheit, die chronische Absenz von Empathie, die einen fruchtbaren Schoß nährt, aus dem die rechte Brut längst wieder munter kriecht?
Womöglich ist die Vulgarisierung des öffentlichen Diskurses sogar politisches Kalkül – als eine Art hemdsärmlige Volksnähe gedacht? Was sich solch hochgestellte Herrschaften eben unter Volksnähe vorstellen mögen. Tatsächlich ist sie nichts als Ausdruck wachsender Verzweiflung und programmatischer Hilflosigkeit angesichts gewaltiger gesellschaftlicher Umwälzungen. Dabei sollte der Wähler voraussetzen dürfen, dass sich – von ihm selbst aufgeblasene – Volksvertreter gerade dann um themenbezogene Lösungen bemühen, wenn sich ihr Mandat mal nicht als Selbstläufer erweist. Ein ungehöriger Mittelfinger wird jedenfalls zu nichts Brauchbarem beitragen. Und natürlich macht es auch formal einen Unterschied, ob ein Konrektor Gabriel im Straßenverkehr verhaltensauffällig wird, oder der Vizekanzler im Fokus der Öffentlichkeit.
Auch ein Minister sollte angesichts seiner Dauerbelastung doch mal aus der Haut fahren – und sich in Sprache und Gestik vergreifen dürfen, sagst du? Erlaube, dass ich mit aller gebotenen Deutlichkeit widerspreche. Da, wo sich Gabriel – so überflüssig wie wählerversessen – unbedingt aufs hohe Ross schwingen musste, wäre er im Interesse der Demokratie besser gleich weggeblieben. Ist doch von vornherein klar, wohin sich eine solch emotionalisierte Konfrontation entwickeln muss. Was wollte er also angesichts einer aufgehetzten Meute da?
Diskutieren kannst du mit schäumenden Chaoten nicht ernsthaft wollen – und das weiß der Mann auch sehr genau. Die Würde von Menschen verteidigen, indem man die am Nasenring durch die Manege führt, die sie ihnen absprechen? Ziemlich kranke Idee. Für mich sieht es tatsächlich so aus, als suchte da ein machtbewusster Politprofi die Auseinandersetzung mit „dem Pack“ sehr bewusst. Um vor laufenden Kameras seine oberpeinliche Werbeshow als markiger Leitwolf eines entsetzten Volkes abzuziehen. Auch ihm ist ganz offensichtlich nichts Besseres eingefallen, als dieses Reizthema für die eigene Karriere kalkuliert auszuschlachten. Vor Journalisten berief er sich patzig auf sein gutes Recht, Emotionen haben zu dürfen, die jedem Menschen zustünden. Und gestand damit selten freimütig, dass er gar nichts begriffen hat.
Des Ministers Gefühlswallungen in allen Ehren. Es sei ihm unbenommen, diesen im vertrauten Kreis auch nachdrücklich Ausdruck zu verleihen. Als Sachwalter von Grundgesetz und den Belangen aller hier lebenden Menschen steht ihm die öffentliche Ausgrenzung missliebiger Meinungsäußerer und Schreihälse – zumal in deren Gossenjargon – nicht zu. Dass die AFD ja bis in die Führungsspitze ebenfalls ständig nach Ausgrenzung kräht, kann für ihn kein Freibrief sein, sich ebenfalls in diese Schublade zu begeben. In der Öffentlichkeit ist er ausschließlich seiner herausragenden gesellschaftlichen Stellung verpflichtet und nicht Hampelmann seiner persönlichen Animositäten und Ängste. Diese Anforderung hat der Minister auch nach mehreren Amtszeiten – und Amtseiden – sichtlich noch immer nicht verinnerlicht. Auch, wenn’s ihm hundertmal nicht in den Kram passt. Auch dieses „Pack“, vulgo Volksverhetzer, Neonazis, Rassisten und Ausländerfeinde sind per Gesetz geschützter Teil jener bürgerlichen Gemeinschaft, deren demokratisch legitimierter Repräsentant er einmal aus freien Stücken sein wollte.
Das muss man sicher nicht gerecht finden, ist aber nun mal geltendes Recht. Die „Rebellen“ könnten sich nicht einmal selbst verbindlich von ihren staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten ausschließen, selbst wenn sie das anstrebten. Eine, qua Geburt erworbene, Staatsbürgerschaft verpflichtet zwar zu allerlei, hat aber auch den unschätzbaren Vorteil, kein Verfallsdatum zu haben. Deine formale Zugehörigkeit zu dieser Nation kann dir keiner nehmen – und das ist ebenfalls verdammt gut so. Hätte Legislative oder Judikative die Macht, angenommene oder wirkliche Undemokraten aus einer demokratischen Gemeinschaft ausschließen zu können, wäre der ganze Rechtsstaat Makulatur. Und in unserem haben auch Menschenhasser verfassungsmäßig ein Anrecht auf Würde, auf Unantastbarkeit, so würdelos sie sich auch gegen andere verhalten mögen, so übergriffig sie sich selbst aufführen.
Ein wesentliches Merkmal des Rechtsstaats ist die strikte Gewaltenteilung. In einem solchen bewerten und urteilen unabhängige Gerichte mögliche Straftaten ab – und nicht ein angefressener Oberlehrer, dessen Schicksal es gefiel, ihn in der gesellschaftlichen Hackordnung ganz weit nach oben zu spülen. Der sicherlich besser beraten wäre, seine Wurstfinger künftig in der Hosentasche zu ballen, wenn ihm nach Wutnickelei ist. Dass Gabriel seine Fehlleistung auch in der Nachbetrachtung hartnäckig weiter als angemessen verkaufen will, wirft in meinen Augen erst recht kein günstiges Licht auf sein Verständnis von einem Staatsamt und der Demokratie schlechthin. Nicht mal als noch so kleines Übel.
Wollte man einem Außerirdischen Toleranz erklären, wäre der Islam als leuchtendes Beispiel eher nicht erste Wahl. Wer was anderes behauptet, lügt motiviert – oder quatscht unbeleckt nach. Frag mal aufgeklärte Frauen im Iran oder anderen Ländern wo die Scharia Gesetz ist. Das hört sich allerdings nach allem anderen an, als nach Laissez-faire. Unzweifelhaft belohnt auch diese Religion jeden treuen Anhänger mit dem Märchen, ein wertvollerer Mensch als jeder beliebige Ungläubige zu sein. Insbesondere die mit Schwänzen. So erwarten den braven Muslim im Jenseits 72 Jungfrauen zum persönlichen Pläsier – als Belohnung fürs Gottgefälligsein im Diesseits. Hingegen die gottesfürchtige Muslima als Gotteslohn genau den Stinkstiefel zurückkriegt, der sie vielleicht schon ihr ganzes Leben als Eigentum betrachtet- und als Blitzableiter, Lustobjekt oder Gebärmaschine hergenommen hat. Zieh dir mal auf einschlägigen Seiten rein, wie besagte Jungfrauen geistig und körperlich offenbar beschaffen sein müssen, um – nicht nur muslimischen – Männern zu gefallen. Wenn du auf der Suche nach ’ner richtig schwanzlastigen Ideologie bist, kannst du hier andocken. Raus kommst du aus der Nummer allerdings nicht ganz risikolos.
So unfassbar wenig durchdacht und abgestanden ein ideologischer Ranz eingebildeter Überlegenheit und unerträglicher Abwertung überhaupt ist, kommt er doch bei schlichteren Naturen unverändert gut. Zuckerbrot und Peitsche ersparen seit jeher das eigene Denken. Kennen wir doch aus der eigenen Vergangenheit zu Genüge. Du konntest blöd sein wie Dosenbrot – als Arier, zumal mit Parteiabzeichen, gehörtest du automatisch zu einer wertigeren Spezies. Die Aufwertung der Einfalt ist auch schon eines der wesentlichen Geheimnisse, warum selbst die durchsichtigsten populistischen Weltanschauungen so beliebt sind. So ließen sich auch andere Religionen getrost einer diskriminierenden Geisteshaltung bezichtigen, ohne allzu weit daneben zu liegen.
Haben nicht auch unsere Pfaffen jahrtausendlang denselben Qualm von besseren und schlechteren Menschen – von Himmel und Hölle – gepredigt und verfolgen in traditionelleren Gesellschaften noch immer eine Agenda von Demut und Fügsamkeit in die zugewiesene Tretmühle? Grundlage dieser Lehre ist die Prüderie. Da gesteht man dir eine einzige Lebenslängliche zu und verspricht dir fürs Jenseits jedenfalls keine Ganztagslatte.
Viele der klerikalen Frommtuer und Heuchler haben, auch wenn sie sich gern weltoffen gebärden, aus der zunehmenden Verdrossenheit der Gläubigen eigentlich gar keine grundlegenden Lehrern gezogen. Tragen lediglich der Tatsache Rechung, dass sie mittlerweile kleine Brötchen backen müssen, damit ihnen überhaupt noch wer auf den Leim kriecht. In Entwicklungs- und Schwellenländern sieht der christliche Klerus häufig noch immer keine Notwendigkeit, von der Kungelei mit lupenreinen Diktatoren Abstand zu nehmen, solange die nur rechts genug sind.
Evangelikale Fundamentalisten, christliche Nationalisten und ähnlich wirre Frömmler werden immer wieder zu Königsmachern in „God’s Own Country“. Von religiösen Splittergruppen zu sprechen hieße indes sträflich untertreiben. Bei diesen, potenziell gewaltbereiten, „Soldaten Gottes“ handelt es sich mittlerweile um ein geschätztes Sechstel der weißen Amerikaner. Man begreift sich als auserwählt, fabuliert von kommenden Kreuzzügen und bereitet sich ernsthaft auf das bevorstehende Armageddon vor. Diese militanten Christen sind schon derart Panne, dass andere Ethnien, Volkszugehörigkeiten oder abweichende ethische und politische Einstellungen in ihren Gedankenwelten allenfalls als „dunkle Mächte“ oder „Sendboten des Bösen“ stattfinden. Wenn sich diese Hinterwäldler das personifizierte Böse da mal nicht schon längst ins Weiße Haus geholt haben.
Auch hierzulande wird von manch ländlicher Kanzel, wenngleich subtiler, noch immer für eine vermeintlich gottgefälligere Politik getrommelt. Was man in diesem Kontext nicht vergessen sollte: Erst dieses Klima von Gottesfurcht, Angstmache und Kadavergehorsam macht einen systematischen Missbrauch überhaupt erst möglich. Ich selbst habe sexualisierte Gewalt als Ministrant nie erfahren müssen, wenngleich mich Fegefeuer und ähnliche Drohkulissen immer wieder auf knochige Kniebänke und in die muffigen Beichtstühle einer oft angstbesetzten Kindheit gezwungen haben. Die eingetrichterten Glaubenssätze sollten zusätzlich das Gefühl vermitteln, auf der sicheren Seite zu sein, weil mich mein persönlicher Schutzengel so unfehlbar durch alle Versuchungen trüge. Gezweifelt habe ich schon damals – ermüdet abgewunken viel später.
Ganz ähnlich gehirngewaschen reisen nicht wenige glühende Anhänger der wahren Lehre tatsächlich noch immer in der naiven Überzeugung an, sie beeindruckten ungläubige Dumpfbacken allein durch physische Präsenz, abgrundtiefe Gläubigkeit und auswendig gelernte Suren. Die Schuldigen an ihrer Fehleinschätzung sind naturgemäß schnell ausgemacht. Am eigenen Horizont kanns ja nicht liegen. Die Gebrüder Özoğuz und ähnliche windige Sektierer geben dem, gleichwohl irritierten, Gläubigen seinen inneren Frieden und ihre geistige Heimat mit Freuden zurück.
Angesichts ihrer Gehaltsklasse dürfte man von beider Schwester allerdings mehr erwarten, als kontraproduktive Empfehlungen zum unermüdlichen Abstecken kultureller Claims. Sonst haben wir bald gar nichts anderes mehr zu tun, als den unterschiedlichsten Erwartungen und Gewohnheiten aller anwesenden Kulturen möglichst situativ und individuell Sorge zu tragen. Eine derartige Einstellung redet nur Integrationsverweigerern das Wort. Wie auch Frau Özoguz offensichtlich schon bemerkt hat, sind nicht alle Zuwanderer an Anpassung oder einer notwendigen Integration interessiert. Viele wollen einfach ihr Stück vom sozialen Kuchen und ansonsten ihr Ding machen. Wer das immer wieder empört in Abrede stellt, ist entweder weltfremd oder komplett in seiner Ideologie verheddert.
Flüchtlinge aus Weltgegenden ohne Recht und Gesetz haben naturgemäß verinnerlicht, misstrauisch zu überleben. Sind häufig, vielleicht auch angesichts Sozialisation und Vorgeschichten, erst mal weder willens noch in der Lage, sich selbstverständlich auf die Spielregeln derer einzulassen, deren Schutz sie in Anspruch nehmen. Ich bin geneigt, die Auswüchse dieser Fehleinschätzungen eher ihren chronisch blauäugigen Supportern und einer praxisfernen Politkaste zuzuschreiben, die sichtlich völlig überfordert bleibt, kategorisch klarzustellen, wer die Regeln in unser aller Gemeinwesen bestimmt und warum diese selbstverständlich auch für Zuwanderer anderer Kulturkreise gelten. Die sowieso schon als regel- und maßlos wahrgenommene Zuwanderung ruft bei der hiesigen Bevölkerung zunehmend Verzweiflung, Wut und Zynismus hervor. Die als bedrohlich empfundene – Atmosphäre im öffentlichen Raum erzeugt Angstgefühle.
Eine AFD hat doch nicht solchen Zulauf, weil sie auch nur eine praktikable Lösung zu irgendeinem Themenkomplex anböte, sondern weil die etablierten Parteien auch weiterhin unbesorgt rumwurschteln, die immergleichen vorgekauten Sprechblasen absondern und mit ihrer unübersehbaren Konzeptionslosigkeit Inkompetenz und Schwäche signalisieren. Die Rechtsextremen in ganz Europa brauchen sich heute tatsächlich nur noch zurücklehnen und abzuwarten, bis ihnen eines Tages auch die Langmütigsten angstgetrieben in die Fänge laufen. Anzunehmen, dass sich Parteienlandschaft und Feindbilder in absehbarer Zeit gründlich verändern werden – und ich gehöre durchaus nicht zu denen, die sich darüber freuen können.
Möchte eine behäbige Einwanderungspolitik tatsächlich tatenlos abwarten, wohin das Gedrängel auf den billigsten Plätzen diesmal führt? Warum ist von einer Richtlinienkompetenz der Kanzlerin kaum etwas zu bemerken? Es mag Balsam für Image und Karma sein, Barrieren spontan zu beseitigen, weil man in seiner Macht auch Humanität beweist. Damit kann der Fall aber keineswegs erledigt sein. Man muss sich um all diese Menschen auch kümmern. Und nur verbindlich zu sein – oder sich keinesfalls unbeliebt machen zu wollen, ist eindeutig zu wenig für eine Regierende. Nicht minder sollte es in ihrer Verantwortung sein, politische Direktiven gemäß ihrem Amtseid vorzugeben, welche gravierende gesamtgesellschaftliche Veränderungen angemessen berücksichtigen. Mit einem aufmunternden: „Wir schaffen das“ ist der Job keineswegs getan.
Man muss kein Prophet sein, um vorherzusehen, dass zu unterschiedliche Wertvorstellungen ohnehin dramatisch wenig Chancen haben, zueinander zu finden. Bei einem „weiter so“ heißt die europäische Zukunft entweder geduldete Parallelgesellschaften oder aufziehende Bürgerkriege und offensichtlich fühlt sich keiner dafür verantwortlich. Verknöcherte völkische und/oder religiöse Dogmen werden eine blauäugige „Inklusion“ auch langfristig sabotieren, egal wie viele schöne neue Vokabeln Schwärmer für ihre Theoreme finden. Weiter zuzusehen bis sich Konflikte verselbständigen und aufschaukeln, kann ja wohl trotzdem nicht ernsthaft Alternative sein. Sollte man annehmen. Wie es aussieht, hat die Ressortchefin für Integration die grundlegende Aufgabenstellung ihres Jobs nicht mal im Ansatz begriffen und vor lauter Korrektheit traut sich auch keiner, einer Doppelquote in die schleifenden Zügel zu fallen.
Integration sollte weder zum Wünsch-dir-was Spektakel noch zum multikulturellen Fingerhakeln verkommen. Und schon gar nicht zur geduldeten Usurpation. Was treibt diese Frau an, religiöse Fanatiker und Kalifatsträumer wider besseres Wissen als konsensfähig verkaufen zu wollen? „Dieser fundamentale Wandel … wird anstrengend, mitunter schmerzhaft sein“, orakelt es sybillinisch aus der Staatsministerin – aber es hört sich kein bisschen nach Zuversicht auf gegenseitigen Respekt an. Klingt eher danach, als ob da eine böse Fee die Menschen fäustchenreibend auslache. Einer Gemeinschaft, der diese Schwätzerin, so durchsichtig wie vorlaut, selbst eine eigene Kultur jenseits der Sprache absprechen möchte.
Durchaus vorstellbar, dass der ehrbare Willy Brandt angesichts soviel unwidersprochener Anmaßung mittlerweile posthum aus der Kleineres-Übel-Partei ausgetreten ist. Die sich bereits mit einer Brioni-Proll-Toleranzprobe als Kanzler nicht mehr so wirklich nach politischer Heimat angefühlt haben wird.
Eine Kindheit inmitten – oder unter – Hamburger Rotzgören mag für die kleine Aydan meinetwegen nachhaltig kränkend oder sonstwie traumatisch gewesen sein. Das ist zweifellos traurig, aber langsam nervts einfach nur noch, dass Emotionskrüppel in derart verantwortlichen Positionen ihre psychischen Baustellen erschreckend regelmäßig zu Lasten ihrer beruflichen Aufgabenstellung abarbeiten müssen. Anstatt vielleicht mal ein bisschen Knete und Lebenszeit für eine vernünftige Therapie dranzuwenden. Oder wenigstens die bunten Pillen nicht andauernd zu vergessen. Die anstehenden schmerzhaften Veränderungen kann ich angesichts solcher Totalausfälle allerdings auch ohne Kaffeesatz und Kristallkugel sehen.
Im Übrigen scheint mir doch ungleich rechtschaffener, das eigene Bündel bei Nichtgefallen wieder zu schnüren, um ein kompatibleres Paradies zu finden, als – in kolonialistischer Manier – Abermillionen Eingeborene peu à peu auf jenen moralisch kulturellen Trip schicken zu wollen – dessen verkniffene Rechthaberei schon in den Herkunftsländern schmerzvoll zu Streit und Leid führt. Muss man unbedingt selbst die heimischen Konflikte importieren, um sich ganz daheim zu fühlen? Viele Muslime beklagen eine wachsende Islamophobie westlicher Gesellschaften. Das haben sie fein beobachtet.
Erwartbar ziehen die meisten halt wieder die falschen Schlüsse. Das Dogma eines göttlichen Determinismus lässt nun mal wenig Raum für realistischen Existenzialismus und nüchterne Selbstwahrnehmung. Kann man sich doch an die Auffassung klammern, dass der Mensch das Schicksal sowieso nicht ändern kann, welches ihm von einer so unfehlbaren, wie unbewiesenen, Instanz zugedacht ist. Das haben die Bequemen kultiviert und fahren in einer Solidargemeinschaft nach hiesigem Muster super damit. Mit Naivität, Bauernschläue, Gerissenheit oder einfach rotzfrech – jeder wie er kann. So bremsen sowohl religiöse Dünkel, wie das Festhalten an einer anerzogenen Passivhaltung vielfach die Motivation aus, in die Niederungen einer veränderten Lebenswirklichkeit hinabzusteigen, um wenigstens fürs eigene irdische Dasein Verantwortung zu übernehmen.
Noch 2015 sind doch unzählige enthusiastische Helfer mit offenen Armen auf hunderttausende Kriegsflüchtlinge zugegangen. Wer könnte die Bilder vom Münchner Hauptbahnhof vergessen? Nicht wenige Ankömmlinge haben den begeisterten Empfang sichtlich als kulturbedingte Schweifwedelei abgespeichert. Und sich dauerhaft in ihrer Opferrolle eingerichtet. Mittlerweile winken viele Supporter nur noch genervt ab, aber die verbliebenen sind eh leidensfähig. Stellt sich da nicht die Frage, ob maßlose Ichbezogenheit überhaupt begreifen kann, dass menschliches Zusammenleben allen Beteiligten ein gewisses Maß an Toleranz abverlangt? Dass alles andere unweigerlich wieder zu jenem Stress führen muss, vor dem man das Weite gesucht hat?
Ich fürchte, Besserwisser können diesen Zusammenhang generell nicht herstellen. Sind sie doch damit ausgelastet, von Bestätigung zu Bestätigung zu taumeln und vom Leben nichts weniger zu verlangen, als ihr Recht darauf, Recht zu haben. Da grenzt dann jede, noch so, sachliche Kritik ganz schnell an Majestätsbeleidung, wird zum Mindesten als respektlos empfunden. When Mimosität meets Animosität. Da es nun aber zur Anspruchshaltung notorischer Rechthaber gehört, selbst Diskussionen um den Bart des Propheten gewinnen zu müssen, wird ganz gern im Rudel angetreten, um dem eigenen Standpunkt Legitimation und Nachdruck zu verleihen. Einfalt erträgt nun mal keine Vielfalt – auch das keine Einbahn. Aus ganz ähnlichen Gründen lehnt übrigens die halbe Welt Amerikaner ab, die ja ebenfalls glauben, auf Argumente verzichten zu können, weil sie anderen Kulturen ihren „way of life“ genausogut einbläuen können. Nicht zuletzt dieser Überheblichkeit wegen quittierte beinahe der gesamte Nahe- und Mittlere Osten 9/11 erinnerlich eher hämisch, als sonderlich mitfühlend.
****
Millionen Zuwanderer mussten sich in den letzten Jahrzehnten sozialen Aufstieg und Lebensstandard in einer, für sie ebenfalls fremden, Welt hart erarbeiten. Die meisten krempelten, noch sprachlos, die Ärmel hoch und waren bereit, sich auch ohne politischen Theaterdonner und ehrenamtliches Tamtam einzubringen – zu integrieren – ohne dabei die Verbindung zur eigenen Herkunft und den Respekt vor Hergebrachtem zu verlieren. Auch sie waren durchaus nicht von Beginn an bei allen willkommen, hatten sich gegen Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung zu behaupten.
Einige der türkischen Opas aus meiner direkten Nachbarschaft wiegen mittlerweile bedenklich die Köpfe. Verzeichnen sie doch eine wieder wachsende Frostigkeit vieler Eingeborener auch ihnen gegenüber. So suchen sie sich, teils mit drastischen Rassismen, von den Neuankömmlingen abzugrenzen. Wollen keinesfalls mit Flüchtlingen in einen Topf geworfen werden. Vielleicht wird ihnen auch langsam klar, dass ihre mühselig freigeschwommenen Enkelinnen die Kopftuchfrage künftig mit stolzen Sprösslingen aus wahabitischen Familien auf dem Schulhof ausfechten müssen.
Jüdische Mitbürger denken angesichts der indifferenten Willkommenskultur und einer, auch daraus resultierenden, kritischeren Gemengelage ernsthaft darüber nach, endgültig aus Europa auszuwandern. Wäre ich seit Jahrhunderten latentes Feindbild für die ganze unheilige Bagage, würde ich allerdings auch sehen, dass ich Land gewänne, bevor die Scheiterhaufen wieder lodern. Wer freilich ausschließlich den bekannt rechten Judenhass anprangert, überhört die Schüsse aus anderen Ecken womöglich vorsätzlich.
Antizionistische Tiraden und antisemitische Narrative nehmen nicht nur bei Al-Quds Märschen Fahrt auf. Die Täter-Opfer-Umkehr läuft im postfaktischen Zeitalter besser als je. Beim Krieg der Bilder sind eindeutig die Gotteskrieger vorn. Da werden aus israelischen Kindern Unmenschen und aus Kinderschlächtern heldenhafte Befreiungskämpfer. Selbstredend sind auch die pseudolinken Psychobratzen zur Stelle, wenn Judenhetze und Randale angesagt sind. Wie bringt man einen Linken dazu, freiwillig rechte Parolen zu grölen? Man schickt ihn auf eine Palästinenserdemo.
Da ist, dank völkerübergreifender Wahnvorstellungen, längst zusammengewachsen, was zusammengehört. Gemeinsame Feindbilder scheinen überhaupt erstklassige Integrationsbeschleuniger, möchte man höhnisch anzufügen. Obwohl bei diesen Deutsch-Arabischen Idiotentreffen immer ungenierter Vernichtungsfantasien skandiert werden, belässt es Politik weitgehend bei Maßhalteappellen und Standpauken. Menschenhassern schleudern wir trotzig die teutonischste aller neuen Volkstugenden entgegen – unsere unbeugsame Toleranz. Betulichkeit und Geduld werden früher oder später noch jeden Fundamentalisten weichkochen.
Echt jetzt? Was stimmt nicht mit uns? Kapitale Lernresistenz? Barmherzige Amnesie? Blanke Idiotie? Weshalb reagiert der Rechtsstaat ausgerechnet beim Schutz der jüdischen Minderheit immer wieder zu fahrlässig? Sind Exekutive und Judikative womöglich schon nicht mehr in der Lage, Rechtsstaatlichkeit konsequent durchzusetzen? Wer bedarf verbohrter Interpreten der Fronten in Palästina, wer will deren Profiteure wie BDS oder Samidoun auf seinen Straßen? Wer braucht das? Na WIR! Wir saugen schließlich alles auf. Weil wir so furchtbar weltoffen sein müssen. Freiheitlich demokratisch bis zur Selbstaufgabe – zumindest, bis das deutsche Fass wieder mal überläuft. Einstweilen sind wir vor allem eins: tolerant und aufgeschlossen – selbst gegenüber Hardcore-Rassisten aus Parallelgesellschaften.
Alles, was bei parlamentarischen Sondersitzungen, meist aus traurigem Anlass, zum Thema Verbot oder Betätigungsverbot regelmäßig und erwartbar kommt, sind Absichtserklärungen: „Wir müssen“, „wir wollen“, oder: „wir werden“. Wohlfeile Solidaritätsadressen an die Leidtragenden. Ein paar Krokodilstränen und, meist mäßig gemimte, Betroffenheitsfressen – fraktionsübergreifend. Zwei, drei Stunden schlechtes Emotionstheater, bevor das Glöckchen zum parlamentarischen Alltag drängt. Nur nichts übers Knie brechen. Mit Augenmaß an das Problem herangehen. Könnten solche Verbote doch leicht als „Religionsrassismus“ oder „antimuslimische Ressentiments“ ausgelegt werden. In diese Ecke gehören wir nun wirklich nicht. Man ist dieser unreflektierten Appeasement-Politik und folgenlosen Sprechblasen so überdrüssig.
Inzwischen hat sich die Bundesrepublik als erste Wahl zum Rückzugsgebiet und logistischen Standort nicht nur für organisierte Kriminalität, sondern auch für internationale Terrororganisationen etabliert. So weit so schlecht. Deutsche Integrationspolitik ist derweil damit ausgelastet, bloß nicht in religiöse Fettnäpfchen zu treten. Sind schließlich nicht alle so. Nö, sicher nicht. Immerhin werden Gefährder, säuberlich nach politischen Präferenzen und möglichen Angriffszielen geordnet, in Datenbanken verwaltet. Damit der Staatsschutz möglichst jenen Überblick behält, den er allerdings auch ganz gern mal verliert.
Wen wundert’s? Wird doch der ganze anmaßende Zirkus selbst für die Akteure immer unübersichtlicher. In einer viel zu kleinen Manege kämpfen ideologische Imperative aus aller Welt um Einfluss. Immer häufiger mit Gewalt. Wie viele, statistisch nicht erfasste – und als gemäßigt geltende – Rechtgläubige nur in ihren Moscheen, Vereinen oder Wohnstuben die weltoffene Larve fallen lassen, um jeden gequälten oder massakrierten Juden hämisch abzufeiern, willst du lieber gar nicht wissen. Viele Eine-Welt-Floristen übrigens auch nicht. Manchmal sind ethische Konzepte wichtiger, als sich mit Nebensächlichkeiten zu beschweren. Auch könnte allzu viel Wirklichkeit den eigenen Positivismus beschädigen.
Mag in diesem Land, frei nach dem Kartoffelkönig, jeder nach seiner Façon glücklich werden, solange er auch andere sein lässt. Meinungsfreiheit heißt aber doch keineswegs, ungestraft zu Gewalt aufrufen zu dürfen oder deren Fratze zu verherrlichen. Ich persönlich muss für niemanden mehr so nett sein, diese Doppelzüngigkeit zu überhören. Erlaube mir, nicht noch mehr hinterfotzige Scharfmacher und Herrenmenschen in meinem Viertel zu wollen. Nicht mal in meiner Stadt. Mir sind schon die Wahnvorstellungen der einheimischen Verschwörungsheinis zu viel. Und kein Mensch braucht immer noch mehr repressive Weltanschauungen. Aus keiner ideologischen Nische.
Mir so wurscht, welche Drangsal, Sozialisation oder Motivation jene Gehässigkeit begründet, mit der religiöse oder politische Eiferer jedes Umfeld unweigerlich auf ihr affektives Level runterziehen.
Was macht eigentlich Dich zuversichtlich, dass sich deine Nachbarn nicht eines fernen Tages klammheimlich über Deine Todesangst amüsieren könnten, Ungläubiger? Wie auch immer. Jeder einzelne Fanatiker ist überzählig. Schon, weil er weitere Gewalt gebiert und eskaliert. So simpel und nachvollziehbar, wenn man nicht in einem Kokon sattgefüttert wird, sondern Alltäglichkeiten ausgesetzt ist.
Anzunehmen, dass diplomatische Bücklinge oder hingehaltene Wangen in den letzten zweitausend Jahren die wenigsten Amokläufer de-radikalisiert haben. Das läuft wohl nur in der Bibel und in Köpfen vernagelter Surrealisten. Auch die Schweden haben die Schnauze von Weltoffenheit und einseitigem Entgegenkommen längst gestrichen voll. Fühlen sich angesichts ihrer blauäugigen Herangehensweise und Gastfreundlichkeit mal richtig über den Nuckel gezogen. Wie ich meine, nicht ganz zu Unrecht. Zum Heulen, was aus dieser, einst so offenen, Gesellschaft und seinen herzlichen Menschen geworden ist. Unfassbar, was heute in Stockholm oder Malmö mitunter geboten wird.
So reizvoll die Idee eines gestalterischen Multiversums je gewesen sein mag, so unrealistischer wird sie doch zusehends. Weshalb sollten kreative Köpfe aus aller Welt ihre Heimat, wofür ihr künstlerisches Fundament hinter sich lassen, wenn sie nicht offensiv an Leib und Leben bedroht sind? Mit was kann beispielsweise eine Berliner Szene noch aufwarten, als mit ihrer krausen Sinnsuche, einem theatralischen Samaritergehabe und dem leichtfertigen Hang zum Romantisieren? Setz doch mal für einen Moment die rosa Brille ab, mein Freund. Willst du mir allen Ernstes anbieten, eine Liaison zwischen solchen Opfern und entwurzelten Glücksrittern könne irgendetwas Schöpferisches, Buntes oder Schönes hervorbringen?
Die trostlose Realität sieht doch so aus, dass die Gesellschaft immer wertebefreiter von einer Unkultur zur nächsten taumelt. In deren Oberwasser sich Dumm mit Dümmer tummelt, Würstchen sich begeistert an Würstchen hochziehen und die Prinzessin von der Schwatzbirne klargemacht wird, die das Maul am weitesten aufreißt. Eine Prinzessin, die zur Groteske einer sittsamen Königstochter verkommen ist. Vorlaut und gewöhnlich – mit lächerlich aufgespritzter Schnute und Silikontitten. Und sehr wahrscheinlich schon tausendfach promisk durchgeknattert. Man möchte sich für diese armseligen Freakshows, die nach allem anderen aussehen, als nach jener verzweifelt herbeigeschwurbelten Bereicherung, ganz weit weg schämen. Am liebsten in eine andere Galaxie. Ist leider wie bei ’nem plattgefahrenen Rattenkönig. Das willst du nun wirklich nicht sehen, bist aber zu paralysiert, um einfach drüberwegzugucken.
Auch mit politischen Schubladen wie „rechts“ oder „links“ ist in dieses Thema eher kein Schema zu kriegen. So sind nach meinen Erfahrungen viele kultivierte Konservative durchaus in der Lage, einigermaßen wertfrei über den eigenen Tellerrand hinauszudenken. Andererseits habe ich zu oft lethargische Ichlinge aus roten Eiern kriechen sehen, um jedem Welterklärer seine uneigennützige Motivation besonders gutgläubig abzukaufen. Ich habe seinerzeit einige dieser zwiespältigen Salonlinken, die ihren kleinbürgerlichen Kokon verzweifelt wegzustrampeln suchten, in meinem Umfeld studieren dürfen.
Studentinnen, die Jeans, Schlabberpulli und geschlechtsneutralen Parka bewusst zum emanzipatorischen Statement machten. Einige Kommilitonen trugen Trotzkibärtchen zur Nickelbrille, um revolutionäre Gesinnung zu beweisen. Die Tiefsinnigeren und Freudlosen zelebrierten antiimperialistische Demos mit der weihevollen Drögheit tridentinischer Messen, während die Kulturbeflisseneren und Lebensfrohen lieber auf sinnenfrohen Happenings rumhampelten. Auch Maulfeministen nutzten schamlos aus, dass manche Kommunardin Gefühle oder persönliches Schamempfinden eher sexistischen Gruppenzwängen unterordnete, als als verklemmte Reaktionärin an den kollektiven Pranger zu müssen.
Einiges, was da unter „sexueller Revolution“ lief, kann man sicher geradeso unter sexueller Gewalt verbuchen, wie das lieblose Gerammel in manch bürgerlichem Ehebett. Wie alle Glaubensfanatiker glaubten allerdings auch die Genossen an die sittliche und geistige Überlegenheit ihrer Lehre. Die Worte des „großen Steuermanns“ und die KoVoz waren für Maoisten unverzichbare Argumentenspender, bei den Genossen Stalinisten wurde wiedergekäut, was UZ und Moskau vorkauten. Politische Gassenhauer wurden, ganz wie in bürgerlichen Bierzelten oder Pfadfinderlagern, zwischen inbrünstig und berauscht – und im Kollektiv intoniert. Andressiertes Konkurrenzdenken und das fehlende Gespür für eine natürliche Solidarität versteckte man notgedrungen hinter gewichtigen Zitaten und solidarischen Phrasen, schon weil akademische Prägung und ideologisierte Denkweisen den Zugang zu handfesteren Themen der Arbeiterklasse mindestens schwierig machen.
Denen, die außerdem von Eitelkeit und einem anerzogenen Bedürfnis getrieben waren, sich unbedingt zu einer intellektuellen Avantgarde zählen zu wollen, musste proletarisches Klassenbewusstsein ohnehin ein Buch mit sieben Siegeln bleiben. Wozu sollten sie sich auch ernsthaft mit den Themen derer auseinandersetzen, von denen sie als Unruhestifter wahrgenommen wurden? Oder, wie es schon 1940 der niederländische Astronom und Marxist Anton Pannekoek aus Arbeitersicht hellsichtig formuliert hatte: „Die Arbeiter haben für ihre Befreiung nicht nur gegen die Bourgeoisie, sondern auch gegen die Feinde der Bourgeoisie zu kämpfen. Das ist kein Kampf nur zwischen zwei Klassen, sondern zwischen drei: den Arbeitern, ihren alten Ausbeutern und denjenigen, die ihre neuen werden wollen“.
Angesichts der herrschenden Verhältnisse konnten die Revolutionsbewegten schon ziemlich zuversichtlich sein, dass ihre schönen sozialistischen Theoreme, die in ihren Fantasien wunderbar funktionierten, sämtlich dazu verdammt waren, folgenlos zu praktischer Marginalität verdorren zu müssen. Für die naheliegendste Lösung, die Genossen hinter dem antifaschistischen Schutzwall durch Zuzug und frischen Wind zu bereichern, fand jeder von ihnen hunderterlei Hinderungsgründe. Den eigenen Absolutheitsanspruch tatsächlich in eine klassenlose Gesellschaft einzubringen, wäre im real existierenden Sozialismus vermutlich auch gewaltig in die eigene Hose gegangen. Ihren sattbürgerlichen Stallmief konnten die meisten nicht loswerden, so prollig sie sich auch im persönlichen Umgang gebärdeten. Befremdlich chauvinistische Frauenbilder rundeten das Bild vom dauerquengelnden Bürgersöhnchen dann nur noch ab.
Besorgniserregender sind die, die ihre Persönlichkeitsdefizite aktuell unter dem Etikettenschwindel einer immer rücksichtsloser agierenden „Antifa“ an wohlfeilen Feindbildern abarbeiten. Revolutionärspathos vom Ramschregal soll der Gewaltgeilheit eine Anmutung von Heroismus verleihen. Autonom ist an dieser Szene so gut wie nichts. Man wohnt noch bei Mutti, oder haust mit Gleichgesinnten in besetzten Häusern. Für den kollektiven Lebensunterhalt sorgt klassischerweise jene Gesellschaft, die man schon aus Prinzip ablehnt und bekämpft. Auch den „Antifaschisten“ fällt das „Konsequent-zu-Ende-denken“ sichtlich schwer.
Fascho – und damit Freiwild – ist alles, was eine nachgerade missionarische Verdammungsmaschinerie in eine faschistische Ecke zu stellen beliebt. Dazu gehört mittlerweile automatisch jeder Polizist. Weibliche wie männliche, jüngere und ältere, Familienväter wie Junggesellinnen – ohne jede Ausnahme. Sobald aus Müttern und Vätern, aus Töchtern oder Enkeln uniforme Masse wird, darf – nein muss – fanatische Beschränktheit Pflastersteine und Mollis nach ihnen werfen. Schleppt Gehwegplatten und Gullideckel auf Hausdächer, um Menschen mindestens maximal zu verletzen. Und glaubt sich ernsthaft in der Tradition jener Couragierten, die seinerzeit dafür ermordet wurden, in einer faschistischen Diktatur Antifaschisten gewesen zu sein. Rotzt mit seiner peinlichen Selbstverklärung gleichsam auf das Andenken von Menschen, die wohl aus tiefstem Herzen verachtet hätten, was dieser schwarze Block heute vorstellt.
****
Rassismus zeige sich zuerst in einer gedankenlosen Ausdrucksweise, heißt es. Leidenschaftliche Sprachhygieniker müssen folglich schon aus Eigeninteresse jedes eigene Wort dreimal umdrehen, wenn sie sich mit einem (unvertrauten) Afro-woher auch-Immer unterhalten. Wie viele stehen wohl innerlich anstrengend stramm, um ja nix Verdächtiges von sich zu geben? Bemühen sich um äußere Lockerheit, damit verborgen bleibe, dass sie in Wirklichkeit keine Sekunde vergessen können, dass ihr Gesprächspartner dunkelhäutig ist. Faseln in einem unbedachten Moment gleichwohl gerne mal davon, wie geil sich Schwarze auf der Tanzfläche bewegen.
Auch ich habe hin und wieder zu gefälligen Rhythmen abgezappelt, was wahrscheinlich eher was von Körperstottern als von koordiniert fließenden Bewegungen hatte. Mag – neben einer arg kopflastigen Motorik – damit zusammenhängen, dass auf den Tanzdielen meiner Jugend das „Headbangen“ oder ähnlich würdelose Bewegungsmuster à la Mode waren. Besonders ungelenkere Jungs erhielten damit ihre Berechtigung, mitzutun. Gleichwohl wäre den Wenigsten in den Sinn gekommen, das unbeholfene Gehampel auch nur ansatzweise mit Pigmentierung oder ethnischer Herkunft in ursächlichen Zusammenhang zu bringen.
Das war allerdings auch zu einer Zeit, als man seine Kontakte noch auf Tanzdielen oder an der Gemüsetheke knüpfte. Da hatte es weder Partner-Apps mit „Matches“, noch solche, die einem die labberige Pizza oder frische Radieschen vor die Wohnungstür lieferten, damit man sich in der ausgebollerten Jogginghose nur ja nicht zu weit von seiner Couch entfernen musste. Die Menschen mussten sich auch noch nicht alle paar Sekunden vom Leben ablenken lassen, grenzdebil dauergrienend und fahrig wie ’ne Schnapsnase auf der Suche nach ’ner versteckten Pulle.
Sind wir doch mal achtsam. Vieler Dasein findet heute, ob allein, zu zweit, oder in der Gruppe, ob Natur oder Café doch hauptsächlich auf einem Spielfeld von vielleicht 7×15 cm statt. Ich erlaube mir ein paar Zweifel, ob sich von solchen Kommunikationskoryphäen ein sensiblerer Umgang mit Sprache – mit Menschen überhaupt – lernen ließe. Ganz nebenbei: Nach gegenwärtigen Erkenntnissen stammt die gesamte Menschheit von einer Urmutter ab – und diese mitochondriale Eva wird sicherlich ziemlich stark pigmentiert gewesen sein. Anzunehmen, dass dieses einzigartige Menschlein trotzdem keinerlei Motivation verspürte, überhaupt mal das Tanzbein zu schwingen.
Viele Ältere nehmen ohne Weiteres für sich in Anspruch, semantisch fragwürdige Typisierungen aus Gewohnheit verwenden zu dürfen. Weil es seinerzeit noch „völlig normal“ war, Menschen verschiedener Ethnien so oder so zu bezeichnen. Falsch. Ganz falsch! Wenn sich Menschen durch unangebrachte Zuordnungen diskriminiert, beleidigt oder gekränkt sehen – und das tun sie immer wieder – hat man das diskussionslos zu respektieren. Sollte sich folglich einer Sprache befleißigen, die eben nicht diskriminiert. Wie grauenhaft mag es sich anfühlen, sein ganzes Leben, Tag für Tag gedankenlos oder absichtsvoll mit einer Terminologie belegt zu werden, die verletzt? Wer jemals Mobbingopfer war, mag eine unerquickliche Vorstellung davon haben.
Debatten mit – meist sowieso nicht betroffenen – Gralshütern der neuen Sprachethik sind hingegen ganz schwierig. Schade um die Zeit eigentlich. Die, meist in einer Art Bauchladen der Korrektheit vor sich her getragene, Rechthaberei dient in erster Linie der Nabelschau und in zweiter dazu, jeden Sprachketzer – ebenfalls zur Selbsterhebung – unnachgiebig an den Pranger zu stellen. Um beispielsweise einen – gern vorausgesetzten – Rassismus beim Gegenüber sogleich dingfest machen zu können, wird jede seiner Aussagen pingelig auf problematische Begriffe oder Redewendungen gescannt.
Als Richtschnur dient diesen Eiferern nicht etwa ein eigenes Sprachverständnis, sondern das Regelwerk der Bewegung – eines neuen linguistischen Absolutismus. Angesichts dessen, dass dieses moralische Messer auch noch ständig unkalkulierbar nachgeschärft wird, wäre doch jeder, noch so mühsam ausgehandelte, Konsens gleichsam eine vorsätzliche Totgeburt.
Beim Thema „kulturelle Aneignung“ erlaube ich mir mittlerweile, direkt abzuschalten. Was könnte eine derart kompromisslose Reduzierung verschiedenster Kultureinflüsse auf ihre jeweilig „Berechtigten“ denn langfristig anderes bewirken, als zivilisatorische Verarmung – und persönliche Freiheiten weiter einzuschränken?
In Oberbayern bist du mit Dirndl und Krachlederner, unbeschadet der eigenen Hautfarbe, unzweifelhaft korrekt gekleidet. Wer wollte einem Touristenpaar aus Shanghai wegen „kultureller Aneignung“ gram sein, wenn sie sichtlich Spaß daran haben, sich für ihren Oktoberfestbesuch als zünftige Bajuwaren aufzurödeln? Schlimm genug, dass man ihnen dieses unwürdige Massenbesäufnis als teutonisches Brauchtum verkauft. Müssen ihnen Besserwisser auch noch ihre Garderobe mies machen? Ändert ihr Aufzug irgendwas für einen „berechtigten“ Lederhosenträger oder die Dirndlmaid aus dem Pfaffenwinkel? Wie kommen kleinkarierte Korinthenkacker auf das schiefe Brett, dass ich es an Respekt vor der Spiritualität der Rastafaris fehlen lasse, weil ich Dreadlocks auch auf meiner hellhäutigen Schädeldecke toll finde?
Mal ganz nüchtern gefragt. Wer könnte die Rechte an der umstrittenen Filzmatte denn überhaupt kulturell oder spirituell für reklamieren? Darstellungen von Menschen mit verfilzten Zumpen finden sich bereits auf minoischen Wandreliefs aus dem zweiten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Die Rastafaris kamen erst in den Dreißigern des zwanzigsten Jahrhunderts, also lange nach den Babas auf den Trichter, ihr Kraushaar ungehindert wachsen zu lassen. Begründen es indessen mit einem Gebot aus dem 4. Buch Mose. Haben sich’s die Jamaicaboys am Ende aber nicht doch klammheimlich von den Sufisten angeeignet?
Derwische aller Ethnien mussten die filzige Haarpracht zeitweise unter ihren Turbanen verstecken, weil sie im Osmanischen Reich als religiöse Ketzer verfemt waren. Auch für hinduistische Sadhus haben ihre hochgesteckte Filzfrisuren traditionell einen spirituellen Hintergrund. Von denen haben sich’s übrigens in den Siebzigern europäische und nordamerikanische Hippies abgekuckt angeeignet. Ich nehme an, die meisten waren sich der tieferen Bedeutung der verdrehten Haarlocken durchaus bewusst. Schon weil viele an Spiritualität interessiert waren und mehr Muße hatten, sich mit dieser Kultur intensiver zu beschäftigen, als die meisten Inder selbst.
Ohne jeden Zweifel hat die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung der 60er und 70er Afrolook und Dreadlocks als Betonung ihrer afrikanischen Identität und damit als politisches Statement begriffen. Gleichwohl trug mein Bruder Matthias seinen Afro so unpolitisch wie stolz, weil seine Krusseln endlich mal ’ne Modefrisur hergaben – und er sich so als Fan von Jimi Hendrix auswies. Ein Alleinrecht auf diese Frisuren abzuleiten, wäre den Black-Power Leuten auch schwerlich in den Sinn gekommen. Die schwarzen Bürgerrechtler hatten nämlich ganz andere Probleme, als beschissene Frisurkontrollen bei Weißbroten.
Am dänisch-norwegischen Hof Christians IV waren die Filzzöpfe im 16./17. Jahrhundert auch schon mal en vogue. Anlass des modischen Kopfputzes war ursprünglich Solidarität mit ihrem, am „Weichselzopf“ erkrankten, König. Und so weiter und so fort. Wer also eignet sich von wem genau was an? Vor allem: Wer dürfte sich anmaßen, den Stab über welcher Filzbirne zu brechen? So ist es doch mit Traditionen. Die meisten besitzen überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal und finden ähnliche Entsprechungen rund um den Globus. Mit mehr oder minder spirituellen Tiefgang. Da gibt es tatsächlich in den wenigsten Fällen etwas anzueignen.
Solche Belanglosigkeiten ficht Verfechter einer reinen Lehre natürlich nicht an. Die epochale Eminenz der aktuellen Mission nimmt die – auf eigenen Wunsch – häufig Geschlechts- und Ethnoneutralen intellektuell wie emotional sowieso schon vollkommen in Anspruch. Da ist kein Raum für Details. Eines der Sprachrohre dieser wunderlichen Streitmacht ist das „genderfluide“ Hengameh Yaghoobifarah. Kam es aus dem fernen Indien, um den „Kartoffeln“ heimzuleuchten, wie einst der weise Osho? Trugen es womöglich Wind und Wellen von den pazifischen Inseln über die weiten Meere? Legten es wie zufällig an unsere Gestade, anmutig wie ein angelandetes Grauwalmädchen?
Der Nasenschmuck vermag seine Herkunft bestenfalls anklingen zu lassen. In Schottland finden sich Nasenringe zwar selbst bei Hochlandrindern, aber das scheint mir doch prinzipiell eher funktionell – denn kulturell spirituell. Woher sollten die zotteligen Gesellen auch von Dämonen wissen, die durch unversperrte Körperöffnungen Besitz von ihnen und ihrem Willen ergreifen könnten?
Dieses, vornehmlich in sub- und pseudokulturellen Welten wildernde, Hengameh kannst du dir als praktisch pausenlos nängernden Nervtöter vorstellen, der weißen Heteros unerbittlich und unterschiedslos Oberflächlichkeit und Rassismus als Serienausstattung attestiert. Um den stoisch generalisierenden Jargon dieser nichtbinären Person einmal maximal nachsichtig zu beschreiben. Selbst alles Queere und sämtliche BPoCs sind in seiner Weltsicht nicht einfach innerhalb einer tolerablen Norm. Sondern einfach nur super. Ich habe selten ein so kompromissloses Bekenntnis zur eigenen Engstirnigkeit gesehen. Teutonen-Spießertum auf allerhöchstem Niveau. Krampfhaft zusammengesuchte Identitätsfragmente sollen offensichtlich dazu verhelfen, bei Bedarf Opfer einer verhassten Gesellschaft mimen zu können. Möglicherweise kann ein Hengameh einfach nicht ertragen, nicht permanent im Mittelpunkt zu stehen.
Für mich sieht es so aus, als ob unser Nono Zufriedenere, Anderstickende oder weniger Limitierte unablässig nölend ans Schienbein treten muss, um sich immer wieder eines Selbst zu versichern, dessen es/sie/er sich sichtlich selbst nicht sicher ist. Da muss man gar nicht lange stochern, in welcher Lebensphase wohl einiges richtig schiefgelaufen ist.
Generell halte ich schon für sehr gut möglich, dass viele Miesepetras mangelnde Sensibilität bei anderen schon deshalb zwingend voraussetzen, weil’s auch im eigenen präfrontalen Cortex eher duster zugeht. Ist aber auch nur so ’ne Idee.
Für mich ist das Gewese um kulturelle Alleinvertretungsansprüche mindestens Beleg für eine piefige Sozialisation der Aktivisten. Manchmal meine ich den Stall noch zu riechen, in dem das eine oder andere dieser arroganten Pinselchen aufgezogen worden ist. Dabei möchten die meisten doch nur helfen, falls die schwarze Frau für eine eigene Meinung zum Kolonialrassismus vielleicht noch gar nicht richtig erhellt ist. Wahlweise ihr schwarzer Kerl. Oder was auch immer. Viele begreifen es offensichtlich nicht nur als Pflicht, augenfälligere Minderheiten dirigistisch begleiten zu müssen, sondern auch als ihr naturgegebenes Recht.
Sollte nicht die Frage Priorität genießen, welche Benefits beispielsweise ein interaktives Böse-Begriffe-Register für die Betroffenen selbst bereithält? Für die wirklich Leidtragenden, meine ich. Wir, als weiße Privilegierte, können uns bei aller redlichen Empathie – oder Solidarität – wohl nicht mal annähernd vorstellen, wie entsetzlich sich dieser strukturelle Rassismus für die Unterminierten anfühlen muss. Der für sie stets gegenwärtig ist, selbst wenn er sich gerade nicht plump aufdrängt. Was es für Menschen bedeutet, über Jahrhunderte und endlose Generationen aufgrund ihrer Hautfarbe als minderwertig missachtet worden zu sein – und zu werden. Wie sich dieser elementare Schmerz in der eigenen Identität verwurzelt hat.
Angeekelte Bürgerkinder schlachten seit Jahrzehnten jedes halbwegs brauchbare Thema für ihren Degout gegen das Milieu aus, dem sie selbst entstammen. Die umfassende Diskriminierung einer Minderheit haben die wenigsten selbst erfahren müssen. Für die Glücklicheren bedeutet die Empörung gegen das System meist nicht mehr als ein spielerisches Sich-Ausprobieren – etwa bis zum ersten Gehaltsscheck. Dann gibt es die, die ihr individuelles Päckchen – manchmal lebenslänglich – zu tragen haben. Wie viele sind schon an unerfüllbaren Erwartungen ihrer ehrgeizigen Eltern zerschellt? Andere mag physische oder sexualisierte Gewalt um ihr Kindsein betrogen haben. Mobbing in der Schule oder im Verein.
Erwachsenwerden kann durch viele Ursachen zur Tortur werden. Irgendwann ist das Selbstbild mindestens gründlich verschoben – in jede vorstellbare Richtung. Anstatt aber, dem Elternhaus entwachsen, Erzeuger – oder gleich den bösen Onkel endlich zu konfrontieren, werden unbeirrbar Themen sprachloserer Minoritäten gekapert und als Vehikel für die eigene Frustration benutzt. Das war bei Mama und Papa, Oma und Opa nicht anders.
Die revolutionsbewegten 68er meinten unbedingt, eine Arbeiterklasse zwangsbeglücken zu müssen, deren Genossen diese „Gammler“ allerdings durch die Bank suspekt waren. Die skandierten Plattheiten werden auch dem Vietcong nicht viel geholfen haben. Hin und wieder durfte ich dabei sein, schon als Zwölfjähriger und im Schlepptau einer angeschwärmten Lehrerin. Jedenfalls habe ich, primär wohl um ihrer Gunst willen jede, noch so dämliche, Parole inbrünstig mitgekräht. Gnade der späten Geburt sozusagen.
Die paar damaligen Maulrevoluzzer, die immer mal wieder durch mein Gesichtsfeld stolpern, garteln verbleibende Lebenszeit und Altersversorgung in künstlich verwilderten, oder Zen-ondulierten Vorstadtoasen ab. Sind in Yogagruppen oder fragwürdigen esoterischen Zirkeln organisiert. Drehpetern mit leuchtenden Augen von Agitprop und freier Liebe – schwelgen überhaupt gern im Ehegestern – ob die Enkel das verklärende Gegäre noch hören können oder nicht. Praktisch sind viele recht bald von bedingungsloser Promiskuität und Rotfront auf grünes Feigenblättchen und zweimal die Woche Hausmannskost umgestiegen – alles rein instrumentell, versteht sich.
Andere leben ihr politisches Rentnerdasein in der Verschwörerszene aus und krakeelen sich auf Bierstallniveau in die Gehör- und Gehirngänge Genervter. Die Ziele entsprechen mittlerweile eher der persönlichen Wertefindung und sind auch nicht annähernd so karrieregefährdend wie das einstige Klassenkampfgeschrei für eine Klasse, der man weder zugehörig war – noch ernsthaft angehören wollte. Was solls aber? Hauptsache, man kann endlich wieder den Rand aufreißen und die Haftcreme hält durch. Ideologische Stringenz geht jedenfalls anders. Nur die verdammten Verdrängungsmechanismen sind einfach nicht auszurotten. Sichtlich gehört einfach wesentlich mehr Mumm dazu, die eigenen Hypotheken gegen innere Widerstände abzuarbeiten, als in immergleichen Reaktionsmustern und unter einem mitfühlenden Deckmäntelchen vereint gegen Obrigkeit, Bullen und Banausen zu pöbeln.
Einige der verkorksten Bratzen von heute haben es sogar – teils mit abenteuerlichsten Herleitungen – mittlerweile ganz gut drauf, sich selbst als Parias zu inszenieren. In Zeiten maßloser Entprivatisierung musst du allerdings schon verdammt dick auftragen, um mediale Beachtung zu finden. Nicht von ungefähr nehmen Anzahl und Spektrum der Geschlechter in einer dekadenter werdenden Gesellschaft inflationär zu. Immer mehr verstiegene Wichtigtuer wollen schon sexuelle Präferenzen oder Orientierungslosigkeit für eine besonders außergewöhnliche Geschlechtszugehörigkeit halten.
Dass sie mit dieser Beliebigkeit jenen Unglücklichen, deren Geschlechtsidentität und zugewiesenes Geschlecht sich seit Kindheit tatsächlich schmerzlich fremd geblieben sind, einen ziemlichen Bärendienst erweisen könnten, interessiert sie nicht. Gilt es doch, Einzigartigkeit zu zelebrieren. Klicks und Likes zu generieren. So packen sie vor aller Welt weinerlich ihren Schmerz darüber aus, gehetztes Einhorn zu sein. Sonnen sich andererseits in Solidarität und Bewunderung der Mitstreiter für die eigene Extravaganz. Leiden vor allem an sich und der Oberflächlichkeit der Unqueeren. Anzunehmen, dass nicht wenige insgeheim beneiden, was sie ständig niedermachen müssen.
Lass dir von solchen Zynikern bloß nie einreden, du wärest unreflektiert, weil es dir meistens ziemlich gut geht. Wenn dir nach Händchenhalten im Park, kuscheligem Heimkino, oder nach Party ist, scheiß einfach mal auf den x-ten Workshop zum Thema: „Diskriminierungsschutz“ oder: „geschlechtliche Vielfalt“. Wer sagt denn, dass ein Mensch in Sack und Asche und mit gesenktem Kopf durch sein eigenes Dasein schlurfen muss, um solidarisch mit den wirklich Bedrängten dieser Welt zu sein? Wahrer Idealismus ist womöglich kategorisch, setzt aber wesentlich eine gesunde Eigenliebe und die Befähigung zu aufrichtiger Toleranz voraus. Diesen Spagat können offenbar immer weniger.
Das will keineswegs, heißen, dass Idealismus nichts als Schall und Rauch bleiben müsse. Indes möchte ich behaupten, dass besonders Hilfsbereite auch ausgesprochen harmoniebedürftig sein müssen. Engagement in der Flüchtlingshilfe bewirkt im eigenen Belohnungszentrum nichts anders, als die tätige Anteilnahme für albanische oder montenegrinische Straßenköter für die einen, oder das zwanghafte Streicheln jeder zufälligen Katze für andere. Wobei ich keinesfalls Zweibeiner mit Vierbeinern in einen Topf werfen möchte. Mach dich locker. Es geht ausschließlich um jene positive Emotion, die Fürsorge beim Fürsorglichen selbst auslöst. Oder so: Auch der barmherzigste Samariter profitiert auf der Gefühlsebene immer vom eigenen Samaritertum – was seine Zuwendung durchaus nicht schmälert.
Ich selbst habe nach sorgfältigsten Abwägungen als selbstfürsorgliche Maßnahme entschieden, dass mich das Elend herrenloser balkanesischer Promenadenmischungen besser nicht weiter beschäftigen sollte. Weiß allerdings ein paar, die würden eher alle flohbewohnten Streuner zwischen Rijeka und Tirana retten, als nur einem einzigen schutzsuchenden Menschen die Hand zu reichen. Ein solcher Wertmaßstab scheint mir dann doch mal bedenkenswert.
Das fahrlässige Katzengestreichle ist mir von jeher nie geheuer gewesen. Von diversen Familienkatzen weiß ich, dass diese Tiere sehr eigene Vorstellungen von Zuwendung haben können. Du beugst dich runter, noch die Worte im Gehörgang: „Streichle sie endlich mal, sie wartet doch drauf“ – und in der nächsten Sekunde hast du einen bleibenden Schmiss am Nasenflügel. Genau darauf hat die linke Bazille nämlich gewartet. Hat deine ignorante Art schon immer gehasst. So wie leinenlose Hunde stets bloß spielen wollen, wenn sie Spaziergängern im Schritt schnuppern. Stellt sich doch unwillkürlich die Frage, was es am menschlichen Gelöt für einen Hund zu spielen gibt?
Indessen ist nicht das Tier sträflich distanzlos, sondern sein Mensch. Erfahrungsgemäß sind unerschütterliche Tierfreunde selten in der Lage, emotional zu begreifen, warum nicht auch alle Welt angesichts ihres Vierbeiners sogleich in einen Zustand ekstatischer Verzückung fällt. Der Satz, der auf den beruhigenden: „Der tut schon nix“ hin und wieder unausweichlich folgen muss, ist das erschrockene: „Das hat der ja noch nie gemacht.“ Zweiteres hab ich einmal selbst hören müssen. Auf einem sanft gewundenen Waldweg im Nordschwarzwald. Das Zamperl hatte im Vorbeigehen ohne ersichtlichen Grund erfolgreich nach mir geschnappt.
Die Hundeführerin war untröstlich, bat wort- und gestenreich um Entschuldigung – und suchte immerhin die Schuld keine Sekunde bei mir. Damit war die hinterlistige Attacke auch aus der Welt. Schuldzuweisung kann dir nämlich beim „Einen-treueren-Freund-findst-du-nicht“ Miesnik zur eiternden Wade noch obendrein blühen. Ganz nebenbei. Ich persönlich fände es schon sehr speziell, wenn mir meine treuesten Freunde ständig zwischen den Stelzen rumschnüffelten. Da fragst Du Dich doch misstrauisch, ob Du die Furche vielleicht doch nicht gründlich genug gewischt hast – oder was sonst im Argen sein könnte, von dem der eigene Zinken nicht zwangsläufig was mitkriegen muss.
Notabene ritzte besagte Beißattacke lediglich Beinkleid und Ego. Allein, weil dieser Hund lächerlich klein war. Nicht viel mehr als zwei Handvoll Hund. Was hätte exponierten Körperteilen blühen können, wenn statt seiner ein spielwütiger 60 Kilo Rotti hohlgedreht hätte? Das möchte ich lieber nicht zu Ende denken.
****
Wir waren beim Idealismus. Ich erinnere mich eines Disputs mit einer beneidenswert hilfsbereiten jungen Frau, die ihre Freizeit der Flüchtlingshilfe verschrieben hat, wofür sie jeden Respekt verdient. Humanität meint bei ihr vorurteilsfreies Engagement und ist mit wohlfeilen Sonntagsreden nicht abgetan. Sie sieht die Welt mit großen braunen Kinderaugen und geht selbst prekäre Themen gewöhnlich mit heiterer Liebenswürdigkeit an. So gestehe ich auch einigermaßen zerknirscht, dass mir ihre stete Unbeirrbarkeit an diesem Tag aus irgendeiner Laune gegen den Strich ging. Kurz: Ich glaubte unbedingt, sie einmal aus der eigenen Komfortzone locken zu müssen. Zunächst war es noch sehr allgemein um Sinn und Unsinn von Religionen gegangen.
Schließlich warf ich wie unabsichtlich ein, dass seit Stiftung der Nobelpreise 1901 gute zweihundert Preisträger jüdische Wurzeln hatten. Dem stehen dreizehn (Stand 2019) gegenüber, die bislang an Muslime gegangen sind. Erstaunlicher umso mehr, wenn man bedenkt, dass der jüdische Anteil der Weltbevölkerung lediglich zwei Promille beträgt, während sich ein knappes Viertel der Menschheit zum Islam bekennt, also satte hundertmal mehr. Ein, leicht zu errechnendes, Verhältnis von zweitausend zu eins kannst Du auch mit bestem Willen weder als Zufall, noch als absichtsvolle Diskriminierung abtun. Obwohl ich zunächst nur die verbreiteten Fakten dargelegt hatte, verfinsterte sich ihre Miene zusehends.
An dieser Stelle räume ich reumütig ein, bei meinen Ausführungen womöglich schon ein bisschen zu augenfällig gegrinst zu haben – und ich kann verdammt dreckig grinsen. Schließlich zog eine drohende Zornesfalte die Augenbrauen zusammen und dann begann es in ihrem, sonst stets von Herzlichkeit durchdrungenen, Gesicht förmlich zu blitzen. Ich war auf manches gefasst gewesen, aber das übertraf jede Erwartung. Sie ließ mich gar nicht mehr zu Wort kommen. Zog über mich weg wie ein stürmisches Gewitter. Zieh mich schändlicher Ressentiments, hieß mich gar einen unerträglichen Rassisten. Ließ mich zu guter Letzt wie einen begossenen Pudel stehen. Klassischer Pyrrhussieg. In ihrem Furor zog sie die angebotene Statistik als Diskussionsgrundlage wohl gar nicht erst in Erwägung. Sah sich in ihrem Lebensinhalt offenbar so elementar angegriffen, dass sie derart heftig reagierte.
Vielleicht hätte ich doch mit dem staufischen Kaiser Friedrich II beginnen sollen, den seine Zeitgenossen das „Staunen der Welt“ nannten und der an seinem Hof in Palermo vor 800 Jahren die klügsten Köpfe um sich versammelt hatte. Darunter viele muslimische Philosophen und Gelehrte aller Fachrichtungen, die als die Belesensten ihrer Zeit galten. Von Al-Andalus, jenem Emirat – und späteren Kalifat von Cordoba, in dem es vor über tausend Jahren ungleich kultivierter und toleranter herging, als im ganzen christianisierten Europa. Das Muslimen, Juden und Christen ein einigermaßen gleichberechtigtes Nebeneinander ihrer Vorstellungen von einem lebenswerten Diesseits ermöglichte. Die Rede ist von einem Islam, der einmal nach Kräften Bildung und Kultur förderte und dessen überwiegende Wahrnehmbarkeit sich durchaus nicht schon von jeher auf reaktionäre Gesellschaftsentwürfe und Legionen blökender Dummbärte beschränkt.
Seine Religion kann sich Mensch, im Gegensatz zu seiner Ethnie, spätestens als Erwachsener selbst aussuchen. Das ist der wesentliche Punkt. Beim Islam handelt sich’s zweifellos um eine der Weltreligionen, die sich folglich nicht ausschließlich Gläubigen einer Region oder Ethnie zuordnen lässt. Gleichwohl bügeln nicht wenige Islamwissenschaftler und andere muslimische Koryphäen von Geltungsdrang Islamkritik gern rundweg als Rassismus ab. Was auch immer das skeptische Hinterfragen oder Aufzeigen menschenverachtender Dogmen sein mag, Rassismus isses jedenfalls nicht. Anzunehmen, dass das sensible Etikett von vornherein jede kritische Frage diesbezüglich diskreditieren- oder den Kritiker mundtot machen soll. Außerdem bietet die konsequent weinerliche Selbstdarstellung als rassistisches Opfer durchaus Vorteile. Lenkt sie doch so schön von der eigenen Engstirnigkeit ab.
Eine konvertierte Gretel aus Gelsenkirchen wird jedenfalls auch unter ihrem Hidschab bleiben, was sie schon immer war. Hellhäutig, ziemlich blauäugig und einigermaßen blond. Die nordischen Stammfarben sollten selbst für den pingeligsten weißen Rassisten kaum zu beanstanden sein. Sehen wir uns Gretels Werdegang zur Anhängerin der Lehre des Propheten doch mal etwas genauer an. Der Name impliziert wie kaum ein anderer blondgezopfte Naivität und so wollen wir der Anschaulichkeit halber bei dieser Personifikation bleiben.
Unsere Gretel war menschgewordene Konsequenz einer lieblosen Nummer auf einer Industriebrache. Den ultimativen Termin zur Abtreibung hatte ihre Mutter ebenso verpennt, wie sie schon die Pille ständig vergaß. Ihr Erzeuger beschäftigte sich gar nicht erst mit „Weiberkram“ wie Verhütung. Der geneigte Leser geht also kaum fehl in der Annahme, dass die kleine Gretel alles andere als ein Wunschkind war. Schon eher ein Verkehrsunfall, wenn ich mir diesen Kalauer erlauben darf.
Man heiratete. Nicht aus Zuneigung, sondern in einer merkwürdigen Anwandlung von Pflichtgefühl und dem sentimentalen Hang zum Trara. Versorgte das Kind mit Nahrung und Kleidung. Gab ihm ein Dach über dem Kopf. Schob allsonntäglich den Kinderwagen durch die Siedlung, um jenen Fertilitätsstolz zur Schau zu stellen, der sich auch in den kuriosesten Namensschöpfungen auf Heckscheiben von Windelbombern exponiert.
Solange Gretel Kleinkind war, hatte Mama hin und wieder noch versucht, sie zu verzärteln – insbesondere, wenn sie selbst einsam war. Papa hielt sich lieber an Hergebrachtes. „Kinder brauchen von Beginn an eine harte Hand, damit sie frühzeitig lernen, wo’s langgeht“, schulmeisterte er bei jeder Gelegenheit. Schob dabei so wichtig den Unterkiefer vor, als sei seine Erkenntnis imstande, zugewandte Pädagogik in ihren Grundfesten zu erschüttern.
Indessen verloren sich Mamas Bedürfnis nach Nähe und Papas Dressurversuche im gleichen Maß, in dem das Kind heranwuchs. Ihre seelenvollen Kindergartenbasteleien verschwanden nach wenigen Tagen unbeachtet im Mülleimer. Schließlich stand schon genug Plunder rum. Gretel war von der ersten Klasse eine durchschnittliche Schülerin. Gab weder Anlass zu Lob noch Tadel. Lief auch in der Schule lange unter dem Radar. Wenn sie sich ein Knie aufgeschlagen hatte, war selbstverständlich ein Pflaster zur Hand, aber selten Trost. Nörgelige Missbilligung über die Störung der Friedhofsruhe – immerhin.
Andere Kinder durfte sie nicht einladen, weil das nur Dreck gemacht hätte. Mama wurde auch so kaum fertig mit Putzen. Papa legte Wert darauf, nach Feierabend seine Ruhe zu haben und verbrachte die Wochenenden lieber mit den Kumpels oder beim Zocken vor dem Bildschirm. Holte Jugend nach und hatte längst wieder andere Interessen, als überkommene Erziehungskonzepte zu reanimieren. Mama hatte sich dreingefunden, dass wohl nicht mehr viel vom Leben zu erwarten sei und war auf dem Weg, mit Vierzig eine alte Frau zu sein.
Der gärende Stillstand in der elterlichen Dreizimmerwohnung schwante Gretel zusehends als eigene Perspektive. Wieviel aufregender lief es in den Fernsehserien, in denen glückliche Menschen in der Morgensonne auf rosengesäumten Veranden frühstückten. Ihr war, als müsse sie im Schatten abgeschossener Fassaden eines Tages selbst zum Schatten werden. Einem Schatten von nichts. In Momenten auswegloser Trostlosigkeit fragte sie sich schon mal, was ein solches Leben für einen Sinn mache. Ihr hielt die Wirklichkeit nicht einen Rosenmorgen bereit.
Das Mädchen hatte nie gelernt, dass auch innige Freundschaft gewöhnlich mit Alltäglichkeiten beginnt. Konnte nicht begreifen, dass Gleichaltrige verstörend fanden, wenn sie ihre Ängste schon bei ersten Annäherungen thematisierte. Gretel fühlte zu tief und folgerte zu oberflächlich. Die Klassenkameradinnen begannen über sie zu tuscheln, sortierten sie schließlich als Unikum aus. Wer sich mit ihr solidarisiert hätte, wäre gleichfalls in Ungnade gefallen. So gab sie zuletzt auch die Hoffnung auf, Freunde zu finden. Und wurde einsam, wie ein Mensch einsamer kaum sein kann.
Wie oft hatte sie sich vorgestellt, nach der Schulzeit ein Handwerk zu erlernen? Verstieg sich in kühneren Träumen gar dahin, etwas mit ihren geschickten Händen zu erschaffen. Begann schließlich eine Lehre als Einzelhandelskauffrau, weil der – gedanklich abwesende – Berufsberater just entsprechende Lehrstellen hereinbekommen hatte. Arbeit sei schließlich nicht dazu da, seinen Spaß zu haben, behauptete Papa. Also fügte sie sich in ihre Ausbildung, wie sich Resignation ins scheinbar Unabänderliche fügt. Fuhr morgens mit der Bahn in die Stadt, füllte halbleere Regale auf, half an der Kasse aus und eilte nach Schichtende wieder nach Hause. Flüchtete in ihr Zimmer und verkroch sich in einer süßlichen Serie vor der dröhnenden Stille unter dem Scheitel.
In ihren adretten Häuschen litten und wuchsen die Fernsehfamilien an ihren Schicksalen. Bekamen Nervenzusammenbrüche und rappelten sich wieder auf. Fielen ins Bodenlose und wurden dennoch stets auf wunderbarste Weise aufgefangen. Überwarfen sich und sanken sich desto glücklicher in die Arme, sobald sich ein weiteres Missverständnis in Wohlgefallen aufgelöst hatte. Dröselten selbst fundamentalste Lebenskrisen einer Folge problemlos in der nächsten auf. Irrungen und Wirrungen halt, die Gretel nur allzu gern gegen ihr milchgraues Schattenreich getauscht hätte. Jeder Stellungskrieg wäre ihr willkommener gewesen, als diese schmallippige, achtlose und lähmende Sequenz, in der sich ihr Dasein verfangen hatte. Die sich in einer Dauerschleife ihr Leben lang wiederholen würde. Nichts machte ihr mehr Angst.
Ihr Moment kam. An einem Septembernachmittag, der für nichts weniger als die Liebe gemacht schien. An dem es wie aus Kübeln gegossen hatte. Als wolle sich der verbrauchte Sommer einem besonders weinerlichen ersten Abgesang hingeben. Ihr Prinz trabte weder auf einem Schimmel in ihre Einsamkeit, noch saß er in einer prächtigen Kalesche. Sondern eher zufällig in derselben Straßenbahn, weil sie sich an diesem Tag vertrödelt hatte. Zunächst nahm sie eher beiläufig wahr, dass ihr jemand zunickte. Sein Zeigefinger zeichnete einen Smiley auf die beschlagene Scheibe – für sie. Ihr Lachen geriet ein wenig unbeholfen – staksige Gehversuche eines Kitzes. Keine Soap kann kitschiger sein als die Wirklichkeit. Sein zugewandtes Lächeln kribbelte bis unter ihre Haarspitzen.
Wie sehr sie herbeigesehnt hatte, gesehen zu werden. Mit seinen funkelnden Augen schien ihr Achmed strahlender als jeder Fernsehstar. Er wurde ihr Erster – natürlich. Etwas anderes hätte seine Grundhaltung gar nicht akzeptiert. Gretel, der Glücksgriff. Ein Manipulator auf der Suche nach einer jungfräulichen Leinwand und eine Traumtänzerin ohne Perspektiven. Selbst die Banalität einer gewöhnlichen Verspätung verklärte sich bald zur göttlichen Vorsehung. Er musste die junge Frau nicht lange bedrängen, bis sie bereit war, mit dem Hidschab ein sichtbares Zeichen ihrer Dankbarkeit – und seines Glaubenseifers zu setzen.
Wir dürfen einen realistischeren Blick auf diese kleine Schnulze werfen. Wie gesunde Beziehungen werden wohl auch Abhängigkeitsverhältnisse meist mehr oder minder süßlich beginnen. Statt beim stolzen Achmed hätte Gretels Sehnsucht nach Geborgenheit nicht weniger fatal bei einem identären Schönschwätzer oder einem „Loverboy“ auf die Schnauze fallen können. Geübte Jäger riechen eine potenzielle Beute auch hundert Meter gegen den Wind. Statt mit emporgerecktem Steiß eingepaukte Suren zu murmeln, würde sie ihren Hintern womöglich nicht weniger vernunftwidrig in einem Laufhaus breitsitzen. Oder irgendeinen Mumpitz von der Reinheit der Rasse nachplappern. Vermutlich gleichfalls, ohne zu peilen, dass sie nicht als Partnerin geliebt, sondern als Subalterne ausgebeutet wird.
Leere Kulissen lassen sich trefflich mit jedem beliebigen Schmarrn aufmöbeln. Und wenn du dich ewig nicht mehr gespürt hast, bist du einfach nur dankbar, wenn einer dieses aushöhlende Grundrauschen von dir nimmt. Fast immer sind es die seelisch Ausgehungerten, die sich für ein bisschen Zuwendung endgültig aufgeben. Manche gehen so weit, sich in einer feiernden Menschenmenge hochzujagen, um die dröge Existenz immerhin durch einen fulminanten Abgang zu veredeln. Zumindest in den Augen fanatischer Glaubensbrüder- und schwestern. Auch Schwarze Witwen oder Märtyrer dürften mehrheitlich vernachlässigte Kinderseelen sein, die um Anerkennung betteln. Genau wie Konvertitinnen – oder Huren. Und all ihre männlichen Pendants. Was sich obenhin nach ´ner ziemlich steilen These anhören mag, macht durchaus Sinn, wenn man das mal konsequent denkt. Stellt sich für den politisch korrekten Bürokraten womöglich noch die Frage, in welche Schublade unsere Gretel als Anhängsel und Sprechautomat eines Rassisten einzuordnen sei.
****
Ich versuche es anders. Mit Bagels kann ich nichts anfangen. Die schmecken brutal fad – wenigstens die, die ich probiert habe. Hingegen liebe ich die Kunafa meiner freundlichen Nachbarin aus dem Erdgeschoss. Geschmack und Geruch wecken Kindheitserinnerungen der schöneren Art. Der Honigduft und das klebrig Zuckrige erinnern ganz wunderbar an den Bienenstich nach dem Rezept meiner Mutter. Eines Tages kommt vielleicht einmal, scheinbar aus heiterem Himmel, das Gerede auf, ich sei Antisemit. Womit könnte ich mich verdächtig gemacht haben? Dass ich nachbarlichen Kontakt zu wenigstens einer Palästinenserin pflege? Einer anrührenden sensorischen Reminiszenz den Vorzug vor einem aschkenasischen Lochbrötchen gebe? Oder genügt mittlerweile schon, dass ich halt zu jenen Säuen gehöre, die aktuell durchs Dorf getrieben werden?
Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich feststellen, dass ich keineswegs auf eigenen Wunsch zur Gruppe der „alten weißen Männer“ gestoßen bin. Sondern als Abkomme mitteleuropäischer Dorfschullehrer, Bauern und kleinerer Beamter ohne mein Zutun verdrießlich schnell älter wurde. Als solchermaßen „zwangsverpflichteter Privilegierter“ kann ich auch leichten Herzens auf Goodies scheißen, die ich nie nachgefragt habe. Und das, ohne mich gleich benachteiligt zu fühlen. Bedeutet das schon, frei von Rassismus zu sein? Ich bitte dich. Wer wollte denn im Vollbesitz seiner Geisteskraft von sich behaupten, jederzeit vergeistigt über menschlichen Untugenden zu schweben? Vielmehr stolpere ich andauernd über meine Vorurteile. Nicke höchst selbstzufrieden, wenn ich im Alltäglichen wieder einmal eines bestätigt wähne. Aber um meine persönlichen Scheuklappen geht’s gerade nicht.
Rassismus ist eine Geißel, seit Noah Kanaan und seine Nachkommen verfluchte und wird Geißel bleiben, solange noch mindestens zwei Menschen unterschiedlicher Ethnien auf dem blauen Planeten rumtrampeln. Der wahre Charakter des Menschen zeigt sich meist sowieso erst in seinem Regiment. Aus Unterdrückten können verdammt schnell Unterdrücker werden, wenn sich nur die geringste Gelegenheit bietet, die Seiten zu wechseln – mithin gesellschaftlich „aufzusteigen“. Das Milgram-Experiment beweist die Mechanismen legitimierter Macht auf erschreckende Weise. Beinahe jeder wird allerdings entrüstet von sich weisen, dass er bei so etwas mitgemacht hätte. Niederträchtig sind doch stets nur die anderen.
Zu behaupten, schon die Zugehörigkeit zu einer Ethnie, Altersgruppe oder Geschlecht prädestiniere geradezu, Rassist zu werden, während andere ebenso verlässlich davor schützten, ist per se eine rassistische Hypothese. Wer Rassist ist, bestimmen Sozialisation, eigene Erfahrungen und die Ideologie/Religion, der man anhängt. Weiters Empfänglichkeit für Stereotypen und der (fehlende) Respekt vor der Lebensweise – auch exzentrischer Lebensentwürfe – von Mitmenschen. Meist bedingt eins das andere.
So ist auch besagter Rassismus „alter weißer Männer“ denselben durchaus nicht exklusiv. Er beschreibt lediglich jenen systemischen Anspruch auf Führung oder Vorherrschaft qua vorausgesetzter geistiger und/oder moralischer Überlegenheit, welcher sich aus einer (willkürlichen) Überhöhung der eigenen familiären, ethnischen oder lokalen Abkunft unvermeidlich herleiten ließe. Der älteste Hut der Welt also. Wozu es dafür aber unbedingt einer neuen Begrifflichkeit bedarf, erschließt sich mir nicht. Haben es „Herrenmenschenattitüde“, „Apartheid“, „Ethnopluralismus“, oder „kolonialistische Grundhaltung“ nicht getan? Wenn ich nur ein bisschen nachdenke, fallen mir sicher noch einige treffende ein, die gleichwohl nicht generalisierend diffamieren.
Hat sich der Sprachreinigungsfimmel Unberufener der eigenen Muttersprache bereits derart entfremdet, dass andauernd neue Simplifizierungen hermüssen? Halten die ultrahumanistischen Vorbeter gar die eigenen Fußtruppen für so schlicht, dass man halt per Bildersprache vermitteln muss, wer liebgehabt werden darf – und wer als pfui abzulehnen ist? Frauen, Divers*innen und jüngere weiße Männer, wie auch jeder schwarze, gelbe oder rote Mann könnten nach dieser Lesart eigentlich direkt mit dem Steinigen loslegen. Um fortwährendes Unrecht zu sühnen. Oder endlich für Egalität zu sorgen. Schließlich hat die Hatz auf gemeinsame Feindbilder die Welt noch stets ein wenig humaner gemacht.
Wäre ein beliebiger „alter weißer Mann“ tatsächlich unverdächtiger, hätte er nur zwanzig Jahre weniger auf dem Buckel? Wenigstens ein asiatisches Urgroßelternteil? Täte es ein Sizilianer in der jüngeren Ahnenreihe? Verdient dieser Mensch ein paar Bonuspunkte, falls er freundschaftliche Kontakte zu Menschen anderer Hautfarbe unterhält? Könnte ihn ein körperliches Gebrechen entlasten, um zugleich als Teil einer Minderheit durchzugehen, die zu diskriminieren Anstand und gesellschaftliche Normen verbieten? Vielleicht wird’s an folgendem Beispiel deutlicher. Stell dir bitte mal vor, du kämpfst allwöchentlich am Infostand von PETA in der Fußgängerzone für das Tierwohl. Unter dem Tresen warten ein paar Sprühdosen auf den selten gewordenen Fall der Fälle. Eines schönen Tages siehst du ganz unverhofft tatsächlich einen Pelzmantel auf euch zuwackeln. Oh Mann! Was kann es als AktivistIn Ehrenhafteres geben, als Seit an Seit mit Gleichgesinnten einen gegerbten Blaufuchs mit grünem oder rotem Acryl plattzumachen?
Ihr seid bereits voll im Angriffsmodus, als du entsetzt feststellst, dass im Fuchsbalg gar nicht die weiße Frau Protzig steckt, sondern unübersehbar eine Romni. Oha – das ist jetzt aber total blöd. Von diesem Augenblick an kannst du nur noch alles verkehrt machen. Verzichtest du aufs Sprühen, hast du nicht nur die vierbeinigen Freunde verraten, sondern bist zudem RassistIn. Warum? Weil Du den Fellfetzen ja nur verschonst, weil ihn eben trägt, wer ihn trägt. Rückst du der Frau gleichwohl auf den Pelz, hast du immerhin symbolische Solidarität mit der geschundenen Kreatur bewiesen. Leider wird man dich unweigerlich des Rassismus bezichtigen, weil …. Wie bitte? Klar ist das polemisch – und wie. Hallo? Weil so durchsichtig ist, dass auch die schöne neue „Zensurkultur“ nur an niederste Instinkte appelliert.
Was macht eigentlich Bruce Jenner? Der war als junger Mann mal Olympiasieger und Weltrekordhalter der Zehnkämpfer. Mehr Kerl geht eigentlich gar nicht. Außer Chuck Norris – oder Judge Dredd. Und Arnie natürlich. Heute, wo Bruce als alter weißer Mann demütig durch die Botanik schlurfen sollte, gibt er als Caitlyn lieber die schöne Jennerin. Ziemlich smart. Geschlecht rechtzeitig gewechselt. Manchen scheint die Sonne wirklich bei jedem Wetter auf den Pelz die Schwarte.
Antirassistische TierschützerInnen werden auch künftig in seltenen Fällen eine Entscheidung zwischen Tierwohl und Rassismusvorwurf treffen müssen. Für viele Romnija ist Echtpelz nun mal unverzichtbares Statussymbol – und daran rührst du als Gadschi/Gadscho besser nicht. Wahrscheinlich hilft da nur noch konzentriertes Woandershingucken, um nicht mit seinem Haltungsdesign durcheinander zu kommen.
Wäre ein solcher Moment nicht der geeignete Anlass, einmal in seiner snobistischen Raserei gegen weniger durchgestylte Lebensentwürfe innezuhalten? Was sich da so vorlaut als Ausbund einer „Political Correctness“ oder – noch peinlicher – als „Woke“ verkaufen möchte, scheint mir doch häufig nichts, als die nächste scheinheilige Inquisition. Muss man noch erwähnen, dass auch das „Wokesein“ von der afroamerikanischen Emanzipationsbewegung aus der Mitte des 20. Jahrhunderts sich angeeignet gekapert nicht nur übernommen – sondern zu allem Überfluss auch noch in seiner ursprünglichen Bedeutung wesentlich kupiert und der eigenen Engstirnigkeit angepasst werden musste?
Von einer souveränen Lässigkeit kann überhaupt keine Rede mehr sein. „Cancel Culture“, der Begriff sagt es unmissverständlich, wurde erfunden, um Menschen mit unerwünschten Denk- oder Verhaltensweisen gesellschaftlich, beruflich und menschlich zu vernichten. Bevorzugt solche, die schon deshalb verdächtig sind, weil ihr Leben in Sphären verläuft, die dem Sozialneid ohne diese Hetzwerke unerreichbar blieben. Wie bei traditionellen Hexenjagden ist auch dieser moralinsaure Mob keineswegs an Gerechtigkeit, Recht oder Aufklärung interessiert, sondern ausschließlich an zynischen Machtdemonstrationen.
Häufig genügt ein Gerücht, um einen Shitstorm auszulösen Das Opfer, schuldig oder nicht, hat gegen die Vielstimmigkeit der Verdächtigungen und die Wucht der Anschuldigungen nicht den Hauch einer Chance. Ständig von Menschenrechten zu faseln und Toleranz für sich und die eigenen Ansichten einzufordern mag recht und billig sein. Die Bereitschaft, hin und wieder auch mal den eigenen Kompass nachzujustieren, leider weit weniger verbreitet.
Um eines nochmal unmissverständlich klarzumachen: Eine Annahme, dass „ältere hellhäutige Männer“ häufiger vom Rassismus befallen sein könnten, als etwa „jüngere dunkelhäutige Frauen“, ist erst mal keine Diskriminierung, sondern qua sozialer Prägung wohl eher wahrscheinlich. Womit wir freilich schon wieder leichtsinnig generalisiert haben. Das ist das Problem an Heilslehren mit Tugendgarantie. Du kannst praktisch kaum noch einen Gedanken äußern, ohne bei irgendeinem Erbsenzähler für Schnappatmung zu sorgen. McCarthys Kommunistenhatz wird kaum unbarmherziger gewesen sein.
Wer sind diese „jüngeren dunkelhäutigen Frauen“? Welche Bilder entstehen in deinem Kopf? Siehst du die drei Grazien, die in einem Diner irgendwo in Georgia so unglaublich ansteckend miteinander gelacht haben? Eine junge Angela Davis, die sich von keinem die Butter vom Brot nehmen ließ, oder eine Drogensüchtige, die im Delir wahllos Passanten anpöbelt? Die Verwandte eines erschossenen Jugendlichen die, völlig außer sich, die Ohnmacht einer drangsalierten Gesellschaft gegen fortgesetzte Polizeigewalt in ein gutes Dutzend Mikrofone schreit?
Siehst du Fulbefrauen, die im Sahel jeden Tag für Stunden zum Wasserholen unterwegs sind? Melanesierinnen in farbenfrohen Wickelröcken auf Vanuatu, die ihre traditionellen Lieder dreimal die Woche für Touristen runterleiern, oder selbstbewusste Weltbürgerinnen, die in Kapstadt Biochemie oder klassische Musik in London studieren? Unerschrockene Wildhüterinnen im Amboseli, die ein paar Wilderer gestellt haben, oder eine somalische Mutter mit leeren Augen, die ein Bündelchen aus Haut und Knochen im Arm hält? Eine Nachtwache, die in einem Hamburger Krankenhaus morgens um halbfünf erschöpft auf einem Stuhl eingenickt ist, oder die minderjährige nigerianische Zwangsprostituierte, die in einer neapolitanischen Psychiatrie sprachlos an der Aufgabe verzweifelt, ihr zertretenes Leben wenigstens einigermaßen wieder zusammenzusetzen?
Jeder wird Bilder assoziieren, die irgendeinmal die eigene Seele angefasst haben. Über die man sich besonders geärgert hat. Oder gefreut. Die nachdenklich stimmen, traurig machen. Die in berührender Weise auf Erfahrenes abzielen. Imstande sind, das eigene Menschenbild beweglich zu halten. Bilder, die die Nachhaltigkeit unserer Vorurteile wesentlich beeinflussen. Stereotype können bei der Orientierung in einer, sich stetig wandelnden, zivilisatorischen Gemengelage helfen. Verallgemeinern andererseits – zuweilen in sträflicher Weise. Niemand kann behaupten, es sei leicht, jederzeit zu differenzieren. Denn auch Sprache verfällt gern in einen nachlässigen Trott. Manchmal spielst du halt deine Rolle oder forderst patzig Reaktionen heraus. Und nicht jeder Tag ist ein guter. Aber du kannst dich immer wieder darum bemühen, möglichst wenig Arschloch zu sein.
****
Bleiben die Bagels. Zählen nicht auch Palästinenser zu den Semiten? Stammen laut Überlieferung nicht alle Völker Vorderasiens von Stammvater Sem ab? Rassismus kannst du praktisch jedem unterjubeln. Wenn es deine Überzeugungen stützt, notfalls mit den absonderlichsten Beweisführungen. Wer ist schließlich gänzlich frei von Vorurteilen? Wer aber bierernst behaupten will, dass sich aus Haken, Knubbel- oder Stupsnasen etwa Geschäftstüchtigkeit, Verschlagenheit oder Lernbereitschaft rückschließen lassen, ist überdies ein Schwachkopf.
Für diese gern noch einmal: Verhaltensmuster offenbaren sich keineswegs in körperlichen Merkmalen oder genetischen Prädispositionen, sondern resultieren ausschließlich aus persönlichen Erfahrungen – individueller Sozialisation – und/oder tradierten Wertvorstellungen jener Gesellschaft, die einen wesentlich geprägt hat – und was die eigene Grütze daraus macht. Die durchaus nicht immer einen Zugang zu den Gepflogenheiten anderer Kulturen suchen muss – oder finden möchte. Und so kann kein noch so andächtiges Wünschen, wird auch das eifrigste Engagement kaum den Bedürfnissen einer ausgemachten Minderheit gerecht werden, ohne einer anderen damit quasi automatisch auf den Schlips zu treten. Diese Einsicht fußt auf Akzeptanz der Tatsache denkbar divergenter Interessen und hat erstmal gar nichts mit Rassismus oder Ausgrenzung zu tun. Oder so: Du kannst auch auf diesem Feld so empathisch um Mitmenschen buhlen wie du willst. Einer fühlt sich garantiert nicht ausreichend gewürdigt, falsch beurteilt, benachteiligt, oder sonstwie beleidigt.
Mag in einigen Fällen damit einhergehen, dass sich der eigene Lebensentwurf sichtlich sehr viel geschmeidiger mit viel Leidensmiene und Lamento durchziehen lässt. Aus jener probaten Opferrolle heraus, die so erfolgreich assoziative Schuldgefühle zu adressieren versteht. Und die auf der beharrlichen Suche nach Verantwortlichen für die eigene Drangsal in einer, von christlichen Schuld-und-Scham Ritualen noch immer dominierten, Kultur allemal fündig wird.
Vielen Zuwanderern, insbesondere aus archaischen Gesellschaften, ist westliche Lebensart mindestens suspekt – oft zuwider. Folgerichtig interessiert diese Menschen auch ein gemeinsames Glücklichsein nach Art des Hauses einen ziemlichen Dreck. Schon von daher müssen sich kategorische Mitfühlslogans wie „leave no one behind“ immer wieder sinnbefreit zu Feenstaub verflüchtigen. Wer seine Nase andererseits allzu anteilnehmend in die inneren Angelegenheiten solcher Strukturen stecken möchte, könnte schneller zum Kollateralschaden seiner euphorisierten Willkommenskultur werden, als er überhaupt „Integration“ stammeln kann.
Wieso fällt das, sonst stets präsente, Einfühlungsvermögen bei dergleichen Themen regelmäßig in eine unerklärliche Schockstarre? Respekt ohne jeden Respons müsste doch selbst dem hingebungsvollsten Menschenfreund in einem lichten Moment als beschämende Liebdienerei bewusst werden. Andererseits hat jene Respektlosigkeit längst begriffen, dass sie nur hämisch mit der Rassistenknute wedeln muss, wenn’s mal nicht nach eigenem Gusto läuft. Schließlich ist kein Mensch illegal. Und überhaupt isses ja nachts sowieso stets kälter als draußen.
Nüchtern lässt sich allerdings mit bestem Willen kaum wegdiskutieren, dass mittlerweile eine signifikante Anzahl von Zuwanderern aus definierbaren Gesellschaften der Allgemeinheit ungleich mehr abfordert, als beizutragen sie je gewillt sein wird. Deren einstige Flucht, vor was und wem auch immer, im Extremfall zu einem hemmungslosen Raubzug gegen Jene ausartet, die ihrer Bedrängnis mehr oder minder bereitwillig Zuflucht und Sicherheit gewährten.
Wurde bereits von Beginn an jedes Angebot zur Entgrenzung arrogant ausgeschlagen, war und ist an Integration solcher Berufskriminellen überhaupt nicht zu denken. Wie mag deren Großkotzigkeit – muss dieses unsägliche Mackergehabe – auf Milchbärte wirken, die vom Leben erst mal wenig mehr als hübsche Autos und schnelle Mädels erwarten? Und wie unterfüttern Herzlieschen und ihr Mitfühlmichel eigentlich so unerschütterlich ihr Wunschdenken, dass diesmal schon gut gehen wird, was bereits mit Schmackes in die Seppelhose gegangen ist? Allein die sogenannte Flüchtlingswelle 2015/16 spülte zehn bis fünfzehnmal mehr Migranten aus Vorderasien und dem Maghreb an unsere Strände, als der gesamte Zufluss an echten und vorgeblichen Libanesen in den späten 70ern, 80ern und 90ern.
Abzocker loten Gesetzeslücken und rechtliche Grauzonen zum eigenen Vorteil aus. Kann man ihnen das wirklich verübeln? Viel fataler ist doch, dass sich eine anbiedernde Politik seit Jahrzehnten darum drückt, entsprechende Gesetze, die seit Jahren aus der Zeit gefallen sind, endlich engmaschiger und – vor allem – zielführender machen zu wollen.
Wessen Interessen werden da noch vertreten? Da können übereifrige Richter Abschiebungen von Familien anordnen, die zwar in Lohn und Brot – und bestens integriert – sind, aber aus den falschen Ländern kommen. Die seit Jahren loyal zur Gesamtgesellschaft beitragen, aber zu treudoof oder mittellos sind, jede rechtliche Hintertür mithilfe cleverer – und zu teurer – Anwälte zu finden. Andererseits können viele ausreisepflichtige Mehrfachtäter nicht konsequent aus dem Verkehr gezogen werden, weil sie sich vom ergaunerten Geld jeden Support leisten können. Viele Zugewanderte aus diesem Milieu haben angeblich ihre Pässe verludert, oder werden von ihren Heimatländern ungern zurückgenommen. Warum wohl?
Zudem überfordere es viele dieser Länder, wenn plötzlich Tausende zurückgeführt werden sollen. Was ist denn mit der steten Überforderung hiesiger Systeme, was mit der signifikanten Verschiebung politischer Kräfteverhältnisse in der gesamten EU nach rechtsaußen? Wie lange kann diese Entwicklung noch nachrangig sein? Bis die jeweiligen Interessen auf der Straße zum Flächenbrand eskalieren? Bis das preisgegebene Wrack komplett ausgeschlachtet ist? Bis wir uns nur noch dran erinnern können, dass wir unsere Regierung mal selbst wählen durften, während die Karawane längst weitergezogen ist?
Nur – für entsprechende Gesetzesänderungen und zwischenstaatliche Vereinbarungen müsste man vielleicht mal den satten Abgeordnetenhintern und ein paar Euro bewegen. Unpopuläre, aber notwendige Entscheidungen treffen – und dafür womöglich auf ein paar Streicheleinheiten der eigenen Klientel verzichten. Selbst in der gemütlichen Schweiz läuft das durchaus geschmeidiger. Dort wird diesbezüglich sichtlich entschiedener ver- und gehandelt.
Auch braucht es nicht allzuviel Lebenserfahrung, sich vorzustellen, dass ein Abschiebepflichtiger glauben will, gar nichts mehr zu verlieren zu haben. Dass mancher auf die wirrsten Ideen verfällt, um seine Abschiebung um jeden Preis abzuwenden. Oder glaubt, sich für seine Zurückweisung unbedingt an dieser Gesellschaft rächen zu müssen. Wenn wieder mal einer durchdreht, ist das für die Medien so verkaufsfördernd wie vorurteilsfördernd für den Pöbel. Politiker dürfen sich flügelschlagend und tief betroffen zeigen. Oder irgendwo dazwischen. Da ist, abgesehen von den Opfern, wirklich für jeden was dabei. Nicht alles, was unter islamistischer Nummer läuft, hat allerdings religiöses Sendungsbewusstsein. Für ein Fanal reicht manchmal schon eine schnöde Stinkwut darüber, die Heimat voller Flausen verlassen zu haben, um ein paar Monate später und tausende Kilometern weiter in einem lichten Moment ernüchtert festzustellen, dass man derselbe entbehrliche Rohrkrepierer geblieben ist, der man schon immer war.
Man stelle sich mal einen Juden vor, der es in den Dreißigern aus dem dreizehnjährigen Reich glücklich über den großen Teich geschafft hat. Die USA gewähren ihm Asyl. Nun verfällt dieser Mensch auf die unselige Idee, 1940 mal eben nach Berlin zu reisen. Um Ferien zu machen, Erinnerungen aufzufrischen, das zurückgelassene Hab und Gut zu checken, ein paar arische Kumpels zu besuchen – oder warum auch immer. Merkst du was?
Zu den rätselhaftesten Mirakeln der aktuellen Fluchtbewegung gehört nämlich, dass mit der Erlangung des Asylstatus – quasi als Bonus – häufig die Freiheit einhergeht, just dorthin reisen zu können, wo doch eben noch das denkbar Schlimmste drohte. Zur selben Stunde vergessen nämlich Assads Schergen, die Religionswächter, wie sonstige Despotenbüttel jäh jedes Interesse an ihren geflohenen Verfolgten. Die diese, quasi durch Amnesie hervorgerufene, Amnestie nicht selten umgehend nutzen, den ersten Heimaturlaub anzutreten. Um womöglich mit wohlfeilen Märchen vom gelobten Land weitere Bedrängte zur „Flucht“ zu animieren. Je zahlreicher die eigene Community, desto geringer wird schließlich der Druck, sich um Integration zu bemühen. Die grenzenlose Reisefreude ließe immerhin den Schluss zu, dass nicht eben wenige Schutzsuchende ihr Bleiberecht tatsächlich einer gefakten Biographie verdanken. Das zu behaupten, röche nach vorherrschendem Moraldiktat freilich schon wieder verdächtig nach Rassismus.
Wunder klingt einfach nicht so despektierlich viel weltoffener halt hübscher. Zweifellos, wer wollte es bestreiten, wird in Syrien oder bei den Mullahs verfolgt, gefoltert und hingerichtet – und die Zahl der Bedrohten wird in die Vieltausende gehen. Sicher mag einigen davon die Flucht gelingen und genau diesen Schutzsuchenden Zuflucht zu gewähren, sieht das Asylrecht ohne Wenn und Aber vor. Bedauerlicherweise wird echten Dissidenten in der Regel gar nicht erst Gelegenheit gegeben, ihren Häschern zu entkommen. Im digitalen Zeitalter hat jede Regierung ihre Widerständler permanent auf dem Schirm. Solche Regimes lassen ihre Gegner nicht ohne Weiteres flitzen, damit sie anderswo weiterrumoren. Vielmehr wird man ziemlich humorlos danach trachten, diese bei nächster Gelegenheit zu „neutralisieren“ oder Exempel an ihnen zu statuieren.
Genau das geschieht vor den Augen der Welt in der Tragödie: „USA gegen Assange“. Der einst attraktive und lebensfrohe Mann dämmert, mittlerweile schwer geschädigt an Physis und Psyche, seiner Auslieferung wegen Landesverrat entgegen. Der darin besteht, als Journalist Kriegsverbrechen amerikanischer Soldaten anhand geheimer Dokumente (das verlinkte Video ist tatsächlich extrem verstörend) öffentlich gemacht zu haben. Vor der Isolationshaft seit 2019 in Belmarsh, einem britischen Hochsicherheitsknast, hatte er bereits sieben Jahre relativ isoliert in einer südamerikanischen Botschaft zugebracht, wo er gegen Ende zusehends Repression und Gewaltandrohung durch genervte Botschaftsangehörige ausgesetzt war.
Der Tiergartenmord oder die Causa Nawalny erzählen ebenfalls davon, wie nachtragend angepisste Regimes sein können. Auf beinahe der halben ganzen Welt verrotten Widerstand und Wahrheit, Unbeugsamkeit und Verweigerung in Isolationshaft oder überfüllten Zellen, wenn nicht sowieso umgehend liquidiert wird.
Die Geschichte der Menschheit ist Zyklen unterworfen. Das bedeutet, nach Aufstieg und Entwicklung jeder Kultur wird auch ihr Kollaps – ihr Fall – früher oder später unausbleiblich sein. Nicht nur dem römischen Kaiser Valens würden die Ohren heute wieder kräftig klingeln. Trotzdem weigern wir uns standhaft, aus geschichtlichen Erfahrungen zu lernen. Weil – wir sind heute soviel weiter und können alles regulieren und kontrollieren
Die Wahrheit ist: Der Niedergang des Übersättigten war von jeher nur eine Frage vom Willen des Hungrigen, satt zu werden.
Möglicherweise werden unsere Kinder und Kindeskinder einmal aus eigener Anschauung erfahren, wie sich das Dasein als Mensch zweiter Klasse anfühlt. Die wird es wenig trösten, wenn ihnen auch dann noch ein paar Klugscheißer unbedingt erklären müssen, dass es schließlich jahrhundertelang umgekehrt gelaufen sei. Kann man vereinfacht so sehen. Wie fast immer schonungslos banalisiert werden muss, wo gefühlsgeleitete Weltanschauungen verzweifelt um Stichhaltigkeit und Evidenz ringen.
Jedenfalls können wir alle auf dieses Kuckucksei so wenig stolz sein, wie auf eine verranzte und ausgeweidete Umwelt, die wir unseren Nachkömmlingen hinterlassen.
Nach welcher Logik sollten Nachfahren aber für jenen Rassismus bezahlen müssen, den die imperialistische Politik einer längst untergegangenen Epoche zu verantworten hat? In vorderster Linie jene, die von diesem Imperialismus nicht mal profitierten. Was läuft da gerade? Wir moralische Überflieger haben den Anstand, wieder heilezumachen, was unsere Vorväter angerichtet haben? Indem wir Legionen von Zuwanderern in Quartiere abdrücken, deren Straßen eher nicht nach Komponisten, Dichtern und Philosophen benannt sind? Irgendwo müssen wir schließlich selbst bleiben.
Sieht so eine faire Willkommens- und Integrationspolitik aus? Die Verdrängung angestammter Bewohner aus der Armeleutestraße wird unausbleiblich in einer vollständigen Gettoisierung des gesamten Viertels enden. Beispiele dafür gibt’s in Europa mittlerweile genug. Man nimmt die Entwurzelten auf und schiebt sie kurzerhand in bezahlbare Quartiere ab. Natürlich könnte man einfach sagen: „Hat sowieso nie was getaugt, die Ecke. Weg mit Schaden“. Wenn’s so einfach wäre. Auch der Wedding bedeutet Heimweh oder Wehmut – ist Kulisse für manch sentimentale Erinnerung. Establishment und Aufsteiger sorgen ja traditionell ganz gern dafür, dass der Plebs gesellschaftlich bleibt, wo er hingehört und möglichst widerspruchslos hinhält. Um die Zukurzgekommenen neuerdings noch als asozial und rassistisch zu framen, wenn sie dann doch gegen ihre ständige Bevormundung und Inanspruchnahme aufmucken.
Anstatt zur Abwechslung mal die eigene Arroganz zu reflektieren, rümpft der weltoffene Humanist lieber pikiert das Näschen, wenn sich im Souterrain interkulturell an die Gurgel gegangen wird. So er das in seiner Zuckerwatte überhaupt mitkriegt. Warum wunderts eigentlich überhaupt noch wen, dass Volksverhetzer mit Schaum vorm Mund und einem Sums aus Sauerkraut und gequirlter Scheiße schon wieder zweistellige Ergebnisse einfahren können? Verdruckte Brandstifter und Angstmacher wie Höcke oder Gauland scheren sich auch einen Dreck um die Nöte vernachlässigter Schichten, aber sie verstehen es geschickter als die etablierten Parteien, deren Ängste zum eigenen Nutzen zu schüren.
****
Schauen wir uns mal in der Nachbarschaft um, wo Politik und Gesellschaft schon ein paar Jahrzehnte länger an einer liberalen Einwanderungspolitik rumdoktern. Müssen bei unserem Besuch beinahe zwangsläufig über die, hierzulande kaum bekannt gewordenen, Missbrauchsskandale von Rotherham, Telford und weiteren mittelenglischen Städten stolpern. Ungleich ekelhaftere Beispiele als die Silvesterhatz von Köln, wohin eine unreflektierte Mixtur aus Schuldkomplex, Willkommenskultur und Ignoranz führen kann, wenn’s für einheimische Underdogs richtig schlecht läuft. Organisierte Zwangsprostitution mit Kindern, die in ihrer Dimension wahrscheinlich nur mit den Tauschbörsen der Pädophilen im Darknet vergleichbar ist. Gleichwohl geht Letzteren die rassistische Komponente ab – und primär um diese geht es hier.
Die minderjährigen Opfer pakistanischstämmiger „Grooming Gangs“ waren und sind ausschließlich „dirty gori“ – dreckige weiße Mädchen. In einem Dokument des Rotherham Safeguarding Children Boards wurde entsprechend ausdrücklich klargestellt, dass die Verbrechen unzweifelhaft kulturelle Eigenschaften aufweisen. Ermöglicht wurde diese Systematik überhaupt erst durch das Wegschauen und Vertuschen aller – auch derer, deren behütete Kinder nicht betroffen waren. Vor allem, „weil man sich nicht dem Vorwurf des Rassismus aussetzen wollte.“ Was offenbar stets vordringlichstes moralisches Anliegen eines korrekt diversifizierenden Humanismus ist. Mit „Gutmenschentum“ hat die durchsichtige Tabuisierung unbequemer Wahrheiten allerdings nicht die Bohne zu tun – ganz im Gegenteil.
Schließlich hatten zumindest „Hindu Council UK“ und“ Sikh Foundation“ den Kanal gestrichen voll. Beide Organisationen verwahrten sich mit Nachdruck dagegen, dass die Täter aus Gründen der „Political Correctness“ so hartnäckig wie schwammig als „Asian“ beschrieben wurden. Diese Ungenauigkeit bringe nur unbeteiligte ethnische Gruppen in Verruf. Sarah Champion, Psychologin und bis dahin unverdächtige Abgeordnete der Labour Party des Wahlkreises Rotherham, half der sprachlichen Unschärfe ab und traute sich tatsächlich, Täter und Motivation zu spezifizieren Champion konstatierte unter anderem: Der Fall stelle „einen organisierten Angriff auf weiße Kinder von Männern aus einer bestimmten ethnischen Gruppe dar“ und weiter, dass „Großbritannien ein Problem mit britisch-pakistanischen Männern hat“. Nicht etwa mit britisch-chinesischen Frauen, indisch-javanischen Brahmaisten, ghanaisch-walisischen Gärtnern, bigotten Schotten oder notorischen Onanisten.
Wurzel des Problems scheint einmal mehr das unrund aufgeblasene Selbstverständnis vieler Anhänger einer überaus menschenliebenden und großherzigen Weltreligion mit Absolutheitsanspruch. Über deren Infamien seit Jahrzehnten milde hinweggelächelt wird, um sich angesichts einer ruhmlosen Vergangenheit nicht immer weiter des Rassismus verdächtig zu machen. Sind ja schließlich auch nicht alle so. Gewiss nicht – aber welcher von denen, die so sind, bringt das Fass zum überlaufen? Und was könnte so verwerflich an der Feststellung sein, dass sich signifikant Männer einer definierbaren Bevölkerungsgruppe zu Hunderten zu Sklavenhaltern über eine andere, ebenso definierbare, weiblicher Teenager aufschwingen, wenn das einfach den Tatsachen entspricht?
Wieso muss die Tätergruppe nicht sogar ausdrücklich in aller Deutlichkeit präzisiert werden, um jedwedem Generalverdacht gegen Männer, asiatische Zuwanderer oder Muslime entgegenzuwirken? Das ist doch derart evident, dass man’s als Mensch von Anstand eigentlich gar nicht mehr wegschwafeln oder relativieren kann, ohne sich permanent mitschuldig zu machen. Jedenfalls lässt sich lebhaft vorstellen, was die bedauernswerte Mrs. Champion mit ihrer Offenheit lostrat. Erwartungsgemäß überboten sich Gute-Welt-Schwarmgeister und diverse Muslimverbände in ihrer Empörung – und verurteilten die Übersetzerin der Nachricht augenblicklich als Rassistin.
Auch Naz Shah, Fraktionskollegin und bekennende Antisemitin aus Bradford, hielt es für vordringlicher, Champions Ausführungen als „aufrührerisch und unverantwortlich,“ zu bezeichnen, als öffentlich einen Funken Mitgefühl mit den Kindern zu zeigen. Zum Tode Winnie Mandelas 2018 twitterte Mrs. Shah ein Bild mit einem Zitat der Verblichenen: „Gemeinsam, Hand in Hand, mit unseren Streichhölzern und unseren Halsketten werden wir dieses Land befreien.“
Unzweifelhaft ein Hinweis auf das „Necklacing“, eine gängige Lynchjustiz an Kollaborateuren des Apartheidregimes in südafrikanischen Townships mit umgehängten benzingetränkten brennenden Reifen. Das tropfende Gummi verschmilzt mit der Haut des Delinquenten und ist praktisch nicht zu löschen. Als sei nur dieses eine Zitat von Frau Mandela überliefert. Wen die verbiesterte Mrs. Shah gern von wem derart unmenschlich befreien würde ließ sie offen, aber allzu viele Konstellationen bleiben ja nicht. Natürlich löschte sie auch diesen Tweet, wie so viele hasserfüllte vorher und nachher, aber gleichgültig, ob man soziale Netzwerke nun sinnvoll oder entbehrlich finden mag, erlauben diese immer wieder aufschlussreiche Momentaufnahmen in Motivation und Seelenleben der Twitternden.
Wir erinnern uns. Die Rede ist von Tweets einer gewählten Abgeordneten des britischen Unterhauses. Einer Politikerin mithin, die im Auftrag ihrer Wähler möglichst viel vom gemeinsamen politischen Willen durchsetzen soll. Die leckgeschlagene einstige Weltmacht ist offensichtlich auch auf dieser gesellschaftlichen Ebene einiges schlagseitiger als der eigene Laden. Gegen die ethischen Kapitalaussetzer der Pakistani-Britin Shah nehmen sich selbst die pathetischen Parforceritte einer Alice Weidel eher wie besoffenes Thekengeschwätz aus.
Gemäßigte Muslimführer erklärten zu den Missbrauchsvorwürfen, dass die Situation hinlänglich von Imamen besprochen wurde – und man zur Überzeugung gelangt sei, dass „dagegen angegangen“ werden müsse. Was alles und nichts heißt. Passiert ist von dieser Seite bis heute sichtlich nichts. Viel wahrscheinlicher scheint mir, dass die patriarchalen Fusselbärte kaum begreifen konnten, was man überhaupt von ihnen wollte. Gori – so what? Außerdem! Hatte nicht sogar der Prophet selbst seine kleinen Vorlieben?
Mrs. Champion kostete ihre Aufrichtigkeit letztlich einen einflussreichen Posten in ihrer Partei. Nicht wenige FraktionskollegInnen rückten hastig von der vermeintlichen Scharfmacherin ab, um die muslimische Wählerschaft ihrer eigenen Wahlbezirke nicht zu vergraulen. Was ganz viel darüber erzählt, welch immensen Druck einstige Randgruppen mittlerweile auszuüben vermögen – nicht immer zum Wohl der Vielfalt. Und über ein Metier, in dem sich moralische Schäbigkeit bevorzugt in feine Zwirne und geplusterte Phrasen hüllt. Wer offensichtlich bereit ist, für die eigene Karriere über tausende von Kinderseelen zu trampeln, wird kaum vor der Integrität einer Kollegin Halt machen.
Was aber ist eine Utopie überhaupt wert, die fortgesetzt unbequeme Tatsachen verleugnet – und Geradlinigkeit verleumden muss? Ich kann daran weder Gutes noch Menschliches finden. Was ich wahrnehme, sind Waschlappen, die aus der heillosen Besorgnis wegsehen und wegschwafeln, als nicht weltoffen wahrgenommen zu werden. Ich sehe gewohnheitsmäßige Betrüger, die über genügend Redegewandtheit und die Dreistigkeit verfügen, ihre kritikbefreite Servilität auch noch im Schaufenster der Nächstenliebe auszustellen.
Warum haben all diese guten Menschen, die Behörden und (auch kirchliche) Institutionen jahrelang nichts unternommen, als Sozialarbeiter, verzweifelte Eltern und die Kinder selbst, immer wieder um Hilfe bettelten? Ganz offensichtlich aus Gründen einer völlig enthemmten „politischen Korrektheit“ und „weil man Rassenunruhen befürchten musste“. Ist diese trostlose Argumentation, ist das armselige Wegducken vor den faktischen Ausuferungen der eigenen Theoreme nicht gleichsam auch finsterster Rassismus gegenüber den Leidtragenden? Können politische Feigheit, skrupellose Stimmenabgreife, aus intellektueller Faulheit resultierende Abwehrreflexe und hartnäckige Verständnishaberei wirklich den Preis wert sein, den chronische Verlierer eines Tages vielleicht auch in diesem Land zahlen müssen?
Nun leben wir heute erfreulicherweise in einer laizistischen Gesellschaft, in der jeder noch selbst entscheiden darf, in welche Hintern er für seine Überzeugungen krauchen möchte. Ob die Katzbuckelei allerdings dafür lohnt, eines – möglicherweise gar nicht mehr so fernen – Tages ein paar Werte aus einer reaktionären Finsterwelt und damit ein Menschenbild integriert zu haben, in dem vor allem Frauen traditionell die Arschkarte haben?
Die Rede ist nicht von schlechterer Bezahlung für gleiche Leistung oder ungleichen beruflichen Aufstiegschancen, sondern von massivster Repression. Einem System, in der eine Frau entweder Eigentum des Vaters oder Ehemanns ist. Von einer Hölle, in der Kinder und Jugendliche anderer Ethnien oder Religionen offenbar ganz selbstverständlich wie Sexspielzeug benutzt werden dürfen. Während wir uns um korrekte Wortwahl sorgen, läuft in Hinterhöfen, die so zugemüllt sind, dass dort nur noch Ratten spielen, die nämliche Nummer in Dauerschleife. Der das, weitgehend marginalisierte und alleingelassene, weiße Subproletariat praktisch wehrlos ausgeliefert ist.
Mittlerweile passen die Söhne der Täter die Töchter der Opfer ab, um sie in eine vermeintlich bessere Zukunft zu entführen. Wickeln die Mädchen mit Süßholz und kleinen Aufmerksamkeiten ein, um auch sie abhängig machen, missbrauchen und ihre Jugend systematisch ausbeuten zu können, wie schon ihre Väter die Mütter dieser Teenager missbraucht und wirtschaftlich ausgeschlachtet haben. Aus Sicht einer, sich auch weiterhin tapfer abschottenden, pakistanischstämmigen Community sind für fortdauernden Kindesmissbrauch und Zwangsprostitution allerdings nicht die eigenen Söhne verantwortlich, sondern „die dreckigen Gören selbst und eine gottlose Gesellschaft, die ihre Kinder zur Unzucht erzieht“.
Kriminelle Organisationen wie diese wurden auch in der Vergangenheit nie konsequent angegangen – womöglich aus politischem Kalkül. Denkbar, dass das Wühlen in dieser Wäsche vielen Wählern zu keiner Zeit vermittelbar gewesen wäre. Wer waren und sind denn schon die Opfer? Britische Prekarier kommen in der Lebenswirklichkeit anderer Schichten entweder gar nicht, oder allenfalls als Paradigma unterstellter Faulheit und Asozialität vor. Selbst kleine Dienstleister und die traditionelle britische Arbeiterklasse grenzen sich mit einer Selbstverständlichkeit von diesen Parias ab, der man tatsächlich nur Snobismus attestieren kann.
Denkbar, dass in diesem gesellschaftlichen Klima Beamte, die mit den wenigen Anzeigen befasst waren, selbst Hand und Hosenlatz aufgehalten- und das Thema nicht mal in die Nähe einer großen Glocke gelassen haben. Heute reichen die Tentakel der Täter bis in die Parlamente, wie man an den kompromisslosen Reaktionen „ihrer“ Volksvertreter sehen kann.
Diesen uferlosen Sumpf jetzt noch austrocknen zu wollen, bedeutete eine herkulische Aufgabe. Die „Pakistani-Britons“ leben teilweise seit den späten Vierzigern im Vereinigten Königreich. Viele hatten in der, 1947 aufgelösten, Britisch-Indischen Arme gedient und suchten nach der Unabhängigkeit Pakistans und Indiens vorsichtshalber im einstigen Mutterland eine Zukunft. Die Mehrzahl der, mittlerweile auf 1,2 Millionen Seelen angewachsenen, pakistanischstämmigen Population hat sich, zumindest im öffentlichen Raum, einigermaßen integriert – oder aus eigenem Antrieb assimiliert. Manche gehören heute zur politischen oder gesellschaftlichen Führungselite. Sadiq Khan, Sohn pakistanischer Einwanderer, hat es etwa zum Bürgermeister von London gebracht, der Banker Sajid Javid, mit einem ähnlichen familiären Hintergrund, in zwei konservativen Kabinetten zum Innenminister und Schatzkanzler.
Anzunehmen, dass zumindest die Integrierten heute im Großen und Ganzen das soziale Profil der Gesamtgesellschaft spiegeln und also weder krimineller, korrupter, oder rassistischer, noch integrer, intellektueller, oder gerechter sind, als der Weißbrite auf einem vergleichbaren gesellschaftlichen Level. Verbindlich wissen kann ich das indes nicht, weil es dazu keine belastbaren Statistiken gibt. Nach meiner Beobachtung träumen Zuwanderer ihre Träume vom sozialen Aufstieg vielleicht ein Quäntchen konsequenter.
Stell Dir vor, Du suchst in irgendeiner Zukunft verzweifelt nach Hilfe und die Beamten schicken Dich weg, weil sie geschmiert, involviert und Teil eines kriminellen Netzwerks sind. Oder auch nur Schiss haben, selbst den Frack vollzukriegen. Beschwerst Dich über Korruption oder Arbeitsverweigerung? Aha. Bei wem denn? Die Masche läuft, weil gerade kleine Mädchen in heruntergekommenen Vorstädten vom Märchenprinzen träumen und Ratschläge wie Ermahnungen vergessen, sobald die Hormone erst mal Purzelbäume schlagen. Läuft, weil die Täter sehr genau wissen, wie man effizient einschüchtert und bedroht. Läuft, weil wir mit unserem habituellen Humanismus eh schon vollkommen ausgelastet sind und selbstfürsorglich wegsehen müssen, wenn was nicht für unser Weltbild taugt. Weil unbeirrbar als Einzelfälle abgetan wird, was unübersehbar Methode hat.
Wir reden klein, sehen beflissen weg und beruhigen das Gewissen damit, dass Abgehängte doch irgendwie auch immer ein bisschen selbst schuld an ihrem ganzen Lebensschlamassel sind. Dürfen einigermaßen zuversichtlich sein, in unserem Häuschen auf dem Land oder der gentrifizierten Gründerzeitbutze in einer korrekten Nachbarschaft ziemlich unerreichbar für jene abseitige Welt zu bleiben. Wenn das mal kein Schuss in den Ofen wird, Freundchen. Schau doch mal aus deinem kultivierten Vorgärtlein raus. Wie lange mögen sich Deine Kinder dergleichen Realitäten noch schönreden können? Woraus schließen Berufsmoralisten, dass sich Parallelgesellschaften, die sich auch nach Generationen derart rigoros abschotten und nach eigenen Regeln spielen, die Gesetze oder moralischen Werte ihrer Wahlheimat eines Tages doch noch verbindlich respektieren, oder auch künftig vor Mittelschichtkindern Halt machen werden? Kriminelle entwickeln sehr feine Antennen dafür, wen sie in einer Gesellschaft relativ ungehindert ausbeuten können.
Der Kulturrelativist übt sein tugendhaftes Primat meist liebenswürdig und sehr verständnisvoll, aber nicht wirklich empathisch im Wortsinn, aus. Ich habe lernen müssen, dass du gefühlsduselige Realitätsverweigerung argumentativ ebenso wenig erreichst, wie dumpfen Fremdenhass. Simple Weltbilder – simple Lösungen. Mit Toleranz, selbst gegenüber durchdachten Standpunkten, ist’s längst nicht mehr weit her. So scheitert’s meist schon am persönlichen Horizont, eine Kausalität zwischen der eigenen Dogmatik und den Konsequenzen fürs soziale Miteinander herzustellen.
Bevor du sie dir fusslig redest, hältst du halt irgendwann resignierend die Schnauze. Überlässt das Feld schulterzuckend militanten Menschenfreunden und Menscheinfeinden, bevor du zwischen die Fronten gerätst. Kannst dich ausnahmsweise mal glücklich schätzen, alt zu sein. Die Zeche für die gegenseitigen Schuldzuweisungen zahlen indes selten die Besserwisser selbst, sondern Menschen, die sowieso ihr ganzes Leben chancenlos auf dem letzten Loch pfeifen. Solange weitgehend unberührte Meinungsführerschaften selbst dem Abartigsten kulturelle Tabuzonen einräumen dürfen, weil sie offenbar um jeden Preis ihre völkischen Fähnchen – respektive ihre vorbehaltlose Weltoffenheit raushängen müssen, wird sich für die geborenen Verlierer auch schwerlich etwas ändern.
Für eine Justiz, die eines Tages doch noch Rechtswege finden mag, einen schwerkranken australischen Journalisten wegen „Geheimnisverrats“ in die USA auszuliefern, dürfte die Rückführung pakistanischstämmiger Kinderficker, selbst der dritten oder vierten Generation, in ihr natürliches Habitat kaum ein juristisches Hindernis darstellen. Ohnehin sollte gesunder Menschenverstand voraussetzen, dass insbesondere Sexualstraftäter generell aus dem Dunstkreis ehemaliger Opfer ferngehalten werden. Weit gefehlt. Zumindest in Großbritannien gesteht man empfindsamen Vergewaltigern in Ausnahmefällen gar zu, Kontakt zu „ihren“ Kindern aufzunehmen. Gibt ihnen damit Gelegenheit, auch die von ihnen Missbrauchten – quasi in einem Aufwasch – zu retraumatisieren.
Wäre es nicht schön, eines Morgens in einer Welt aufzuwachen, in der keine Mutter mehr hilflos zusehen muss, wie ihr Kind systematisch benutzt, prostituiert und seiner Menschenwürde beraubt werden kann, weil es keine durchsetzungsfähige Lobby hat? Was mich an ein paar Liedzeilen des steirischen Barden Ludwig Hirsch erinnert.
Es gibt Kinder, die kommen ohne Schutzengel auf d’Welt
Und der Sandmann haut eane Reissnägel in d’Aug’n
Unter’m Christbaum liegt jedes Jahr
A Packerl Tränen als Geschenk
Und ein Märchenbuch
Wo der Teufel immer gwinnt
****
Die Schicksale der Menschen, die in Europa anklopfen und unisono erzählen, bedroht und auf der Flucht zu sein, sind naturgemäß so verschiedenartig, wie ihre Erwartungen Gemeinsam ist ihnen in den allermeisten Fällen sicherlich der Wunsch nach einem soliden sozialen Unterbau für das eigene Dasein. Dieses, durchaus nachvollziehbare, Ansinnen teilen sie freilich mit mehreren Milliarden Menschen weltweit. Von denen die meisten um keinen Preis freiwillig in Systeme migrieren würden, die eigenen Anschauungen derart diametral zuwiderlaufen. Gleichwohl machen sich In den letzten Jahren immer mehr Verzweifelte aus subsaharischen Regionen, wie auch aus Mittel- und Südasien für die Hoffnung auf eine bessere Zukunft auf den gefährlichen Weg. Vielleicht gehört man ja zu denen, die es tatsächlich schaffen – wenn nicht, kann man immer noch weitersehen.
Wer nie etwas besaß, muss ohnehin bleiben, wo ihn das Leben abgelegt hat. Wem es finanziell ein bisschen besser ging, ist meist von Schlepperbanden so gründlich abgebürstet worden, dass er nichts mehr besitzt. Und wer Höllen wie die Sahara, wer Algerien oder Libyen und das Mittelmeer überlebt hat, ohne den Verstand zu verlieren, mag die Hoffnung auf sein Bleiberecht womöglich aus der Tatsache beziehen, dass er doch unmenschliche Strapazen dafür auf sich genommen habe. Hätte man stattdessen in seinem Drittweltslum Däumchen drehen sollen, bis die eigene Lebenszeit einfach runtergelaufen ist?
Wieviel Mumm, Verzweiflung oder Risikobereitschaft muss es brauchen, das Gewohnte, den Rückhalt von Familie und Freunden hinter sich zu lassen, um in einer fremden Kultur ein besseres Leben zu erhoffen? Wie wollen wir aus einer ökonomischen Sattheit heraus beurteilen, wie wir handeln würden, hätten wir eine solch fundamentale Entscheidung für uns zu treffen? Die Geschichte von Vertreibung und Verlassenmüssen ist, wie die Sehnsucht nach Ankommen und Bleibendürfen, so alt wie die Menschheit selbst.
Stellt sich aber auch die Frage, warum ausgerechnet so viele Muslime ihr Heil in einer, von ihnen verachteten, dekadenten und gottlosen Gesellschaft suchen? Man sollte doch meinen, bei den eigenen Glaubensbrüdern- und schwestern müsse das Leben aus vielerlei Gründen wesentlich angenehmer sein. Wo sollen sie hin? Jordanien beherbergt bereits Hunderttausende aus den Nachbarländern und ist damit nach eigener Darstellung an den Grenzen des Machbaren. Der Libanon als Heimstatt komplett verbrannt. Knappen sieben Millionen Einwohner stehen etwa anderthalb Millionen Flüchtlinge allein aus Syrien gegenüber. Dazu kommen ein paar tausend Iraker, Sudanesen und andere Afrikaner. Eine halbe Million Palästinenser.
Auch in der Türkei zählen die Flüchtlinge nach Millionen. Deren Führung sich diese Dienstleistung allerdings fürstlich honorieren lässt. Für mich ist alles an dieser Vereinbarung einfach nur schräg. Die EU zahlt Unsummen dafür, dass die türkische Regierung Anhängern der eigenen Staatsreligion Obdach gewährt? Halb Europa macht sich nackig und legt einem Erdogan vertrauensvoll die Klöten in die Faust? Eine wahrhaft diplomatische Meisterleistung. Sieht im Übrigen so aus, als wären die meisten Türken ihre ungeladenen Gäste lieber heute als morgen los. „Die Syrer nehmen uns Arbeit und Wohnraum weg“, glauben viele. „Die Flüchtlinge sind an unserer schlechten wirtschaftlichen Situation schuld“, lamentieren sie. Kommt mir irgendwie bekannt vor.
Die reiche Verwandtschaft in Saudi-Arabien und den Emiraten will mit den abgerissenen Brüdern und Schwestern seit jeher nur das Nötigste zu tun haben. Dabei tragen die Golfstaaten nicht weniger Schuld an der Destabilisierung Syriens und der daraus resultierenden Massenflucht, als die Weltmächte. Schließlich finanzierte man im Syrienkonflikt von Beginn an IS und weitere islamistische Gruppierungen. Nun könnte man im Zeltlager von Mina – von jetzt auf gleich – drei Millionen Schlafplätze in klimatisierten Zelten bereitstellen. Die allerdings exklusiv für Mekkapilger während des alljährlichen Haddsch vorgehalten werden, um die restlichen fünfzig Wochen des Jahres ungenutzt leer zu stehen.
Selbst Arbeit wäre für die Kriegsflüchtlinge bei gutem Willen wohl ausreichend vorhanden. Indessen bevorzugt man auf der arabischen Halbinsel robustere genügsamere effizientere Rassen Süd- und Südostasiaten als Sklaven Arbeitsmigranten. Die sind spottbillig, praktisch unbegrenzt nachwachsend und nehmen sich nicht ständig Schwachheiten raus. Verweilen, vor allem, nicht alle paar Stunden minutenlang kontraproduktiv in Häschenstellung, um ihren Schöpfer zu preisen. Schließlich sind Betzeiten vom Rechtgläubigen zeitgenau einzuhalten. Schwierig, wenn gerade frischer Beton verarbeitet werden muss.
Natürlich fürchten die Potentaten am Golf auch, dass ein „revolutionärer Geist“ ins eigene Wohnzimmer getragen werden könnte. Und für Unfrieden dürfen die Schutzsuchenden gerne anderswo sorgen. Kurz – keiner der sechs Golfstaaten gewährte in Not geratenen Menschen jemals Zuflucht- auch nicht heimatlosen Palästinensern oder hungernden Jemeniten. Nicht einem. Soviel zur schrankenlosen Solidarität der Umma (muslimische Weltgemeinschaft).
So überlässt eine stinkreiche Staatengemeinschaft die humane und logistische Bewältigung der Zwangslagen ihrer Brüder regelmäßig dem Westen. Was soll falsch daran sein? Immerhin verdient sich der Kāfir mit Nächstenliebe seinen Himmel. Außerdem. Weshalb sollte man Schwärme von Schnorrern durchfüttern, wenn diese an neuen Ufern viel praktischer missionieren – und den ganzen Bettel eines fernen Tages vielleicht sogar in eigener Sache übernehmen können? Für die Verbreitung ihres radikal-islamischen Wertekanons öffnen wahabitische Monarchen nämlich durchaus bereitwillig ihre Schatullen.
Jetzt mal unter uns MasochistInnen. Angesichts der Wurstigkeit dieser Rechtgläubigen so unerschütterlich wie erschüttert über die Hartherzigkeit der „Festung Europa“ zu räsonieren, hat schon was vom Betteln nach der Zuchtrute. Mal unabhängig davon, wie emotional man selbst an der Misere all dieser Entwurzelten beteiligt sein mag. Schon statistisch liegt auf der Hand, welch tiefgreifende Veränderungen auf die eigene Gesellschaft noch zurollen. Und ökonomisch? Einmal Plausibilität ohne Schmalz bitte! Ein Gemeinwesen muss grenzenlose Menschenfreundlichkeit schließlich auch dauerhaft finanzieren können.
Wie viele derer, die sich blauäugig für einen ungeregelten Zuzug einsetzen, müssen wohl selbst gemeinwirtschaftlich gepäppelt werden? Weil sie nicht willens oder in der Lage sind, fürs eigene Dasein zu sorgen. Mit voller Hose ist sichtlich auch in der Hängematte gut stinken. Was machen Transferempfänger aber, wenn eines Tages alles abgeräumt sein sollte, was verteilt werden kann? Wenn auf einmal jeder selbst sehen muss, wie er klarkommt? Schult der hauptberufliche Aktivist auf Rassist um, weil schließlich irgendwer schuld am persönlichen Lebensdrama sein muss? Werden womöglich plündernde Mobs durch die Straßen marodieren und sich von Schwächeren mit Gewalt nehmen, von dem sie glauben, dass es ihnen zustehe?
Die Belastung derer, die aktiv zum Gemeinwohl beitragen, stößt längst an die Grenzen alles Zumutbaren. Und Milliardäre endlich konsequenter fürs Sozialsystem zur Ader lassen zu wollen, mag prinzipiell schon ’ne ganz famose Idee sein, ist aber nüchtern auch nicht mehr als Populistengeschwätz. Wenn’s eng im eigenen Haus wird, kaufen sich globalisierte Superreiche eine neue Staatsbürgerschaft und empfehlen sich endgültig dorthin, wo ihr Vermögen schon auf sie wartet. Derart Gestopfte wird man übrigens fast überall begeistert mit Teddybärchen und goldenen Pässen bewerfen – dich und mich wohl eher nicht.
Realistisch – nicht statistisch – bringen viele der Zuwanderer als Qualifikation geringere – jedenfalls kaum vergleichbare – Schul- oder Berufsabschlüsse mit. Zur fehlenden Grundlage kommt die Sprachbarriere. So wird es in den meisten Fällen für eine einigermaßen anspruchsvolle Ausbildung – etwa als gesuchte Pflegekraft – außer mit sehr viel Eigeninitiative kaum reichen. Wie viele der – vorläufig noch immer – potentiellen Fachkräfte wollen sich diesen Stress für Schichtarbeit und eine wenig angemessene Entlohnung überhaupt geben, wenn’s keine Ehre unter Ihresgleichen einbringt? Hinzu kommt, dass „richtige Männer“ Pflegeberufe eher nicht so prickelnd finden und Bildungsdefizite lieber mit Testosteron satt kompensieren, als der Einfalt abzuhelfen. Ihre Schwestern werden häufig in einer freien Entfaltung ausgebremst, weil sie seit Geburt für ihre traditionelle Rolle als Ehefrau und Mutter verplant sind. Da ist zunächst ganz viel zielführende Integrationsarbeit angesagt.
Auch der sprachkundige syrische Arzt wird kurz- und mittelfristig Ausnahme bleiben. Der fand anfänglich kaum Zeit, sich einzuarbeiten, so stolz wurde er von Talkshow zu Talkshow weitergereicht. Davon ganz abgesehen, dass er jetzt in Syrien an allen Ecken und Enden fehlt. Der Markt für Rosenverkäufer, Barbiere, Kebab- und Burgerbräter ist hingegen mehrfach gesättigt. Was sich derzeit in westlichen Industrieländern an statistischen Erfolgsmeldungen diesbezüglich selbst feiert, resultiert doch nicht unwesentlich aus einem gnadenlosen Verdrängungswettbewerb im Niedriglohnsektor. Für den eingestellten irakischen Paketfahrer sitzt häufig einer auf der Straße, der auch nicht mehr als diesen Job hatte – und jetzt einen ziemlichen Hals auf alle Neuankömmlinge schieben mag. Wohingegen Betreiber von Lieferservices, Dönerbuden oder Logistikunternehmen naturgemäß recht glücklich über den steten Nachschub an Aushilfen, Saisonarbeitern und scheinselbständigen Selbstausbeutern sein werden.
In der Realität verschachtelter Subunternehmerkonstrukte ist der gut gemeinte Mindestlohn ohnehin nie angekommen. Schon weil die bezahlten Stunden einfach nie ausreichen, das geforderte Pensum zu schaffen. Wer die Frechheit besitzt, seine Rechte einzufordern, wird rausgeekelt. Mobbing ist zweifellos billiger als jede arbeitsrechtliche Auseinandersetzung. Wie viele von Katrins Menschengeschenken in einer solchen Ellenbogengesellschaft scheitern und über Jahre alimentiert werden müssen, lässt sich allenfalls ahnen. Nicht neu ist, dass sich die Frustration über fortgesetzte Abfuhren immer wieder in Gewalt, insbesondere bei selbstüberschätzenden jungen Männern – ausnahmslos aller Hautfarben – Bahn bricht.
Selbst das einst weltoffene Beirut hat auf die harte Tour lernen müssen, was es bedeutet, wenn die Bevölkerungsstruktur zu schnell und unreguliert in Schieflage gerät – und etliche europäische Großstädte sind längst auf dem Abstieg in die gleiche Liga. So ist in einigen Vorstädten Brüssels oder Birminghams, Malmös oder Marseilles das Recht des Stärkeren bereits Gesetz. Stadteile wie Marxloh, Altenessen oder Neukölln befinden sich auf dem schlechtesten Weg dazu. In manche Straßenzüge gehen nicht mal hartgesottene Bundespolizisten noch besonders forsch rein. Wie sollst du auf Dauer mit dem Zwiespalt fertig werden, dass die Rettung der Bedrängten dieser Welt offenbar nur über den Niedergang deiner eigenen zu machen ist?
****
Loblieder auf eine kunterbunte Projektgesellschaft kann doch mittlerweile nur noch singen, wer diese Realität tapfer auszublenden versteht, oder als eigene Daseinsberechtigung bis zum Jüngsten Tag schönmalen und kleinreden muss. Meist braucht man gar nicht genauer hinzuhören. Gefühliger Sermon trifft durch Tremolo – er kann auf Tiefgang verzichten.
Und ihre Wähler? Passt schon. Auch für grünlackierte Neos gilt in Bezug auf Nachhaltigkeit die Maxime, bei aller Umwelt immer schön Realist zu bleiben. Das läppischste an diesen Wir-trennen-den-Müll-Umweltschützern, Unsere-Maßstäbe-Antirassisten und Manchmal-sind-Kriege-moralisch-Friedensfreunden ist ihr reflexgesteuerter Aktionismus und die Rührseligkeit, mit der sie immer wieder auf ihr Selbstbild reinfallen.
Die Urgrünen hatten sich vor allem basisdemokratische Sachpolitik auf die Fahnen geheftet. Eine pazifistische Politik, die Alternativen zur hemmungslosen Ausbeutung von Ressourcen und Menschen in Entwicklungsländern wollte. Abschaltung von AKWs und eine Priorisierung der Forschung nach alternativen Energien. Eine Politik jenseits von Kapitalismus und Kommunismus, die damals die Weltordnung unmissverständlich unter sich aufgeteilt hatten. Die Idealisten wollten Emanzipation des Menschen jenseits aller Stanzen. Ein großes Ziel, gewiss. Wahrscheinlich zu groß für menschliche Unzulänglichkeit. Beim Gründungsparteitag suchten linke Aktivisten mit heimatvertriebenen Revanchisten nach Gemeinsamkeiten, Christen rangen mit Marxisten um Deutungshoheit. Neben dem gemeinsamen Zielen wollte man naturgemäß möglichst viele seiner ideologischen Positionen verwirklicht sehen. Was konnte daraus entstehen? Der häkelnde Zausel neben einer stillenden Mutter blieb hängen.
Bereits die Bundesversammlung 1982 zeigte die Grenzen der Basisdemokratie auf. Es begann eine Zeit endloser Personaldebatten, wachsweicher Verhandelbarkeiten und vorausschauender Klientelpolitik. Sponti-Kanaillen wie Fischer und Cohn-Bendit hatten den, (freilich nie ganz) emissionsfreien, Kahn geentert und kamen mit beneidenswert manipulativen „realpolitischen Positionen“ rüber, um beim Platzhirschgerangel ganz oben mitzumischen. Mit dem Ziel, der ineffizienten Basisdemokratie eine lebensnahe Führerschaft vornanzustellen. Wie in jedem Politbetrieb sollten von da an auch bei den Grünen möglichst viele Idealisten einige wenige Karrieristen tragen.
Beide entstammten unterschiedlichen Strömungen der linken Frankfurter Szene. Die sogenannte „Putzgruppe“ des „Revolutionären Kampfs“, der nur Fischer angehörte, gab vor, das Großkapital von einer „revolutionären Basis“ her gewaltsam attackieren zu wollen und erreichte damit erwartungsgemäß so viel wie Straßenköter, die einem vorbeidonnernden Vierzigtonner unbedingt die Reifen kaputtbeißen wollen. Am Ende hast du tatsächlich nichts als Kollateralschäden. Die verhassten Kapitalisten schlugen sich ob der blutunterlaufenen Raserei allenfalls wiehernd auf die Schenkel. Die Folgen der menschenverachtenden Gewaltausbrüche hatten andere zu tragen.
Viele der altgedienten Straßenkämpfer hatten Klassenkampfgedröhn, Rotfrontpalaver und die ermüdende Wochenendbeschäftigung mit Zwillen und Mollies gegen Schlagstöcke und Wasserwerfer eigentlich satt. Suchten längst nach altersgemäßeren Zerstreuungen. Nur die Verbisseneren hielten unbeirrt an Revolution und Umsturz fest und radikalisierten sich weiter. Einer von Fischers Kampfgenossen, Hans-Joachim Klein wurde vom Sympathisanten der RAF zum Mitglied der Roten Zellen und war unter anderem an den drei Morden bei der OPEC-Geiselnahme in Wien beteiligt. Fischer hat es vermutlich dem mäßigenden Einfluss von Daniel Cohn-Bendit zu verdanken, im Spiel geblieben zu sein. Der hielt einige Frankfurter Klassenkämpfer davon ab, sich weiter zu radikalisieren. Die neue Partei versprach eine vielversprechendere Zukunft. Naturgemäß konnte der abgebrochene Untersekundaner Joschka nie Student sein, hatte sich aber schon früh in die Vorlesungen von Habermas oder Negt geschlichen und ein veritables bildungssprachliches Vokabular zugeeignet. Das kam ihm jetzt zupass. Er begrub den Schläger und brachte Führungstalent und Eloquenz in Stellung. Der schleichende Marsch durch legitimierte Volksvertretungen und in Regierungsverantwortung konnte beginnen.
Der „rote Dany“ mag regen Austausch zu heikleren Gesellschaftsthemen erhofft haben, während der handfestere Joschka wohl von Beginn an begehrlich auf die Honigtöpfe schielte. Diese beiden moralischen Sandsäcke haben jedenfalls nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass die Grünen jederzeit bereit waren und sind, fürs Mitregieren auch grundlegende Programmatik aufzuweichen. In der realistischen Rückschau sind denn auch nicht eingelöste Wahlversprechen eher Regel als Ausnahme. Geschadet hat ihnen der fortwährende Verrat an ihren Kernthemen allerdings auch nie besonders. Die schöne Unschuld ist halt futsch.
Die Alphatiere der Fundis müssen schön blöd aus Latzhosen und Selbstgestricktem geglotzt haben, als ihnen dämmerte, dass da eine taxifahrende Nebelkerze ganz geschmeidig rechts an ihnen vorbeigeraucht war. In die Niederungen der Nachhaltigkeit hat sich ein Fischer nie wirklich begeben. Seltsamerweise erwartete das wohl auch keiner – und das hätte schon damals misstrauisch machen müssen. Fischer interessierte sich stets nur für Fischers Außenwirkung.
Einfach alles an diesem falschen Fuffziger diente persönlichen Ambitionen. Selbst seine Treter schienen immerzu ankumpelnd zu rufen: „Wähl mich, ich bin wie Du“ – um auch beim einfältigsten Idealisten eine Sympathiestimme abzugreifen. Eins muss man dem geriebenen Gestaltwandler lassen. Seine windelweiche Rebellenshow verfing bei den verschiedenartigsten Bevölkerungsgruppen. Rudolf Bahro, Philosoph, Sozialökologe und sperriger Querdenker (u.A. der Grünen), hat die willfährige Denkfaulheit der Massen mal so ausgedrückt : „Eigentlich ruft es in der Volksseele nach einem grünen Adolf.“ So krass das formuliert sein mag, trifft es in der Sache voll auf den Punkt. Die Neigung zum Denkenlassen ist tatsächlich an keine politische Zielsetzung gebunden. Ich persönlich begreife nicht, was an Volkstribunen oder Dogmen immer wieder so spannend sein soll. Die Masche ist weder neu, noch ist sie sonderlich originell. Und trotzdem einfach nicht totzukriegen. Selbst meine Mutter, die ansonsten über ein unfehlbares Gespür für alle Arten Luftpumpen verfügte, stolperte über ihre, nicht weniger ausgeprägte, Neigung fürs Hemdsärmelige – und fiel prompt auf Fischers Proletenfolklore rein.
Nach Jahren wechselnder Erfolge endlich im Außenministerium angekommen, pellte sich der wandelbare Tausendsassa unversehens aus seinem abgetragenen Aufmüpfkokon und schlüpfte in einen Maßzwirn. Entpuppte sich als wunderschö reichlich öliger Staatsmanndarsteller. Der in seinem Ministerbüro sogleich und ganz doll stolz, ein Foto seiner Aufstiegssneaker aufhängen ließ. Das war dieser unbezahlbare Moment, an dem ihm seine Eitelkeit endgültig die Revoluzzerbuxe über dem kleinbürgerlichen Arsch runterzerrte. Mutter verlor nie wieder ein Wort über „diesen Parvenu“, aber eine Menge Leute lässt sich bis heute nicht in ihrer Bewunderung beirren. Sie weigern sich einfach, sich die vermeintlich aufregende Legende hinter einem charakterlos changierenden Opportunisten kaputtmachen zu lassen. Wohl weil sie untrennbar mit ihren eigenen Träumen oder Lebenslügen verbunden ist.
Was unterscheidet das kleine vom feinen Naturell? Feine Menschen setzen nicht voraus. Würden dir nie das Gefühl vermitteln, du seist ihnen das Geringste schuldig, selbst wenn du ihnen eine Zukunft verdankst. Solche Klasse ist weder käuflich, noch zu erkaufen. Hingegen kleine Leute aller Provenienzen prinzipiell nach Wert und Gegenwert taxieren, bevor sie was angehen. Leiern auch noch den letzten Cent aus ihren Begabungen, Beziehungen und vermeintlichen Gefälligkeiten und können doch nie das Gefühl loswerden, unter Wert angeschissen worden zu sein. Solche Erbsenzähler sollte man sich schon aus Gründen der ethischen Hygiene von der Seele halten.
Bei gierigen Menschen drängt sich mir unwillkürlich die Frage auf, was sie treibt, immer mehr und immer unmäßiger zu raffen? Wie viele Millionen kann es brauchen, seine Erben versorgt zu wissen? Ich meine, der Typ wird weder Gelegenheit noch allzuviel Lebenszeit übrig haben, so viel Kohle unter die Leute zu bringen. Bisher sind noch alle mit leeren Händen gegangen. Und die Beigaben, die man noch nach Jahrtausenden unangetastet in Pharaonengräbern gefunden hat, sprechen sehr dafür, dass selbst ein toter Halbgott in seinem spekulativen Jenseits nix mit dem irdischen Krempel anfangen kann.
Hätte es Fischer nach dem Ende seiner Amtszeit nicht bei seinem ministerialen Rentnerdasein bewenden lassen können? Die fünfstellige Ministerpension mitgenommen, schmunzelnd über die Leichtgläubigkeit der Menschen und seine eigene Gerissenheit? Für die kleinen Extras vielleicht ab und zu mal einen ordentlich dotierten Vortrag zur außenpolitischen Lage aus seiner Sicht als „elder statesman“ gehalten? Den Fans auf einer Buchmesse, selbstironisch und rausgefressen wie vor der manischen Hatz, „den langen Lauf zu sich selbst“ um die Ohren gehauen, er wäre als grünlackierte Gallionsfigur der Verehrung wenigstens ansatzweise würdig gewesen. Aber Fischer wäre nicht Fischer, hätte er sich mit dem Erreichten bescheiden können.
Aus einer provinziellen Krämerseele kann aber auch kein Mann von Welt werden, so distinguiert er sich auch gerieren mag. Trotz aller unbestrittenen Intelligenz steckt dieser Mensch in Denkart und Habitus eines pfennigfuchsenden Taxifahrers fest. Raffgier frisst jedes Format. Einer wie Joschka wird nie anders können. Er muss einfach mitnehmen, was vor ihm liegt. Wie ein Straßenköter. Der schlingt auch weiter, wenn er längst satt sein sollte.
Zu Bescheidung und Selbstironie fehlt selbst dem hellsten Kleingeist einfach die emotionale Grütze. Gewesenen Genossen, die ihm immer mal wieder Stillosigkeit oder Verrat an gemeinsamen Idealen vorwerfen, unterstellt er Neid. Ich denke, davon ist er wirklich überzeugt. In seiner Vorstellungswelt sind ideelle Werte so etwas wie Masken, die man sich vorhalten kann, um Moraldefizite zu verbergen. Da es bei ihm so ist, muss es bei anderen auch so sein. Ein gnädiges Geschick hat diesem Menschenverächter wirklich jede seiner Bösartigkeiten nachgesehen und darüber vergessen, ihm vielleicht mal pädagogisch in den Arsch zu treten. Solche Versäumnisse müssen bei Charakterschwächlingen zu Realitätsverlust führen.
Der Metzgersspross aus der schwäbischen Provinz hatte nie ein Problem damit, seine ideologischen Rösselsprünge zu begründen. Er sei erst als Taxifahrer vom linken Idealisten zum Realisten geworden, triefte er einmal hängebackig nostalgisch in eine willige Gazette. Achgott ja, die Schule des Straße. Das erklärt natürlich alles. Als „Realist“ musste er wohl unvermeidlich Teil jener verhassten Welt werden, die er als „Idealist“ vor den Bürotürmen im Westend noch wutschnaubend und außer sich vor Hilflosigkeit angekläfft hatte. Die er zwei Jahrzehnte später als Außenminister immerhin schon aus nächster Nähe ansabbern durfte. Und die nach der verlorenen Wahl 2005 als letztes Lebensziel auf seiner Agenda stand. Wie verlockend muss es gewesen sein, einer Klasse zuzugehören, die nicht auf Maskeraden und gleisnerische Verheißungen angewiesen ist, um sich qua wankelmütiger Wählergunst eine noch wackligere Macht zu erschwindeln.
Herr Fischer, wie er sich mittlerweile anreden ließ, war mehr als bereit. Das joviale „Joschka“ mit dem er noch wenige Jahre zuvor selbst internationale Vortrage unterzeichnet hatte, vertrug sich längst nicht mehr mit seiner Selbstwahrnehmung. Auch waren die Weggenossen ja nun längst aus dem Blickfeld – zumindest nicht mehr gleichrangig. Er legte den Joschka im persönlichen Umgang so geflissentlich ab, wie seine lästig gewordenen Parteiämter. Konnte er doch bereits schmecken, wie süß es sein müsse, sich selbstverständlich in Kreisen zu bewegen, die über die sagenhafte Autorität und den Reichtum zu verfügen, selbst abgewählte Regierungschefs und obsolete Minister mal eben zu käuflichen Marionetten zu degradieren. In der Macht auch ohne Winkelzüge und falsche Versprechungen bei einem bleibt, weil deren Fundamente schon vor Generationen gefügt worden sind.
Mangels eigener Masse entschied sich der umtriebige Herr Fischer für den Weg eines „Unternehmensberaters.“ Sah sich endlich auch für den ganz großen Scheffel stark genug. Sie brauchten ihn nicht mal zu locken. Der alte Fuchs diente seine multinationale Beziehungen und Umweltkompetenz mit der Penetranz eines abgewichsten Marktweibes an, das einen Fisch von vorgestern als fangfrisch unterjubeln will. Ließ seine universelle Qualifikation von den ehemaligen Feindbildern RWE, Siemens oder BMW als nachhaltiges Feigenblättchen verdingen. Jedenfalls das, was der ungute Umgang mit „seinem Altkanzler“, der zwischenzeitlich vom Putins Kumpel zu dessen Pudelhund avanciert war, an Integritätsfraktalen übriggelassen hatte.
Auf die Frage eines Journalisten, was denn seine „Manufaktur“ von anderen Beraterfirmen abhebe, sprachs gemessen aus dem Politphilosophen: „Meine Beratung hier ist die Fortsetzung der Außenpolitik mit anderen Mitteln.“ Aber Hallo. So gekonnt bläst nur ein wahrer Meister der gepflegten Worthülse die eigene Inhaltsleere auf. Bloß, was heißt das genau? Garantierter Zugang zu den Ressourcen der Drittwelt? Der heiße Draht zu Despoten aller Art? Bli bla blopp?
Jedenfalls wähnte sich der kregle Speckes fortan auf Augenhöhe mit Industriellen und internationalen Wirtschaftskapitänen. Die klopften dem Karriereristen zwar ausgiebig die Schultern, hatten ihm allerdings das juvenile nach-Kollektivierung-krähen keineswegs vergessen. Lassen ihn bis heute nicht merken, dass er weder „Sparringspartner*in“ noch Mitspieler, sondern allenfalls Pausenclown und Ökodekor im Rektum der Quandts und Konsorten sein darf. Die paar Euro für imagefreundliches Greenwashing sind für Konzerne eher Lappalien.
Anfang der Zehnerjahre kam mir der Realo-Raffke mal auf dem Uferweg irgendeines Berliner Sees entgegengestolpert. Ich meine, es müsse der Schlachtensee oder die Krumme Lanke gewesen sein. An einem sonnendurchfluteten und wellenglitzernden Herbsttag jedenfalls und in geschnorrten Nikes wahrscheinlich. War wohl gerade mal wieder beim temporären Abspecken, der Jo-Jo Joschka. Dampfte schwabbelig, schwitzend und ziellos geworden an mir vorüber und der nächsten Fressattacke entgegen. Ich schwöre, in diesem einen unverstellten Augenblick tief in sein inneres Leichenhaus gesehen zu haben. Das war schon ein verdammt seltsames Gefühl. So, als müsse mir diese würdefreie arme Sau dann doch ein bisschen leidtun.
Passé die Zeiten, als Spitzenpolitikerinnen aller Parteien ihre Ämter nur deswegen zukamen, weil sie notgedrungen einiges mehr an Eloquenz und Expertise mitzubringen hatten, als die meisten ihrer krawattentragenden Kollegen. Selbst brillant zu sein, reichte meist nicht für eine Hauptrolle. Mittlerweile scheint als Befähigungsnachweis für manche Politkarriere schon zu genügen, anatomiebedingt klüger im Sitzen Pipi zu machen.
Ein, seit den frühen 80ern apodiktisch durchgezogenes, Frauenstatut verhindert längst, was es erreichen sollte. Inkompetenz fördert ausschließlich Inkompetenz. Heute verfügen die Bundesgrünen auch ohne eine Iryna Gaydukova längst über ein stupendes Personaltableau, wie man es selbst in Oberpfälzer Ortsverbänden der Freien Wähler nicht oft antrifft. Die grünen Reviermatronen sind schon aus Gründen der Selbsterhaltung damit ausgelastet, etwaige Fachkompetenz, umweltorientierte Redlichkeit, oder basisdemokratisches Zähneknirschen von potenteren Mitbewerberinnen bereits im Ansatz unterzupflügen.
In einem Milieu steter Selbstbeschäftigung muss Sachpolitik in ihren Fundamenten verkümmern. Gleichwohl sind Basis und Stammwählerschaft keineswegs unschuldig an dieser grünen Seifenoper. Bei mir zeitigt Annalenas neunmalkluges Geplapper jedenfalls nur Erschöpfungssymptome. Vielleicht noch irgendwas zwischen Rührung und Ratlosigkeit. So mag sichs etwa anhören, wenn eine Dreijährige auf Koks ist. Welcher Erwartung können Parteivolk und Wähler sein, denen eine solche Schnatterliesel irgendeine brauchbare Kompetenz vermittelt? Und eine Klientel, die selbst nach zwei Jahrzehnten pathetischen Geweses und Gehampels noch immer nicht genug von trompetendem Trampel unter Topfschnitt hat, verdient wohl einfach, Realsatire als seriöse Politik verkauft zu kriegen.
Wenn dann auch noch eine tief bewegte Katrin ihre triefende Moralität zu Markte trägt, frage ich mich endgültig, ob die so penibel wie unsensibel gehandhabte Einhaltung dieser Frauenquote womöglich noch immer einem vorausschauend eingefädelten Plan angepisster Parteipaschas der alten Fischer-Schule ( „Quotzen“ ) folgen könnte. Ist ja auch astrein gelaufen. Die Gesellschaft macht männliche Unfähigkeit in den seltensten Fällen am Geschlecht fest. Hingegen der Geschlechtszusammenhang bei sichtlich überforderten Politikerinnen immer wieder hergestellt und ausdrücklich betont wird. Wenn Qualifikation zur Nebensache gerät, weil ein solch geschlechterbezogener Proporz über allem steht, wächst naturgemäß die Wahrscheinlichkeit, dass dergleichen Vorurteile immer wieder bestätigt werden. Quoten nützen in erster Linie allen Arten von Seilschaften und Protektionismus. Wie in jeder beliebigen männlichen Hierarchie drängt es ja keineswegs die fähigsten Kandidatinnen in die erste Reihe, sondern bestens vernetzte Schwadroneurinnen und Selbstversorgerinnen.
Wie wär’s zur Abwechslung mit einer geschlechterneutralen Quote, ausschließlich nach Gesichtspunkten fachlicher Eignung? Die anhand belegbarer Ausbildung oder mittels einer eingehenden Prüfung Qualifizierung genauso sachlich feststellt, wie eine Handwerkskammer? Ohne jede Berücksichtigung von Gefühlsgequäke und Klüngelei. Das täte sicher nicht nur der jeweiligen Aufgabenstellung gut. Ganz viele Führungstableaus in Wirtschaft und Politik wären auf einen Schlag deutlich effektiver zusammengesetzt. Und garantiert nicht weniger ausbalanciert. Eine stumpfsinnige Frauenquotierung ohne Berücksichtigung irgendeiner Befähigung kann seriöse Gleichstellungsbestrebungen und das Ende einer patriarchalen Politik nur bis zum Jüngsten Tag sabotieren. Wer sich in sozialen Dynamiken auch nur ein bisschen auskennt, kann genau das erwarten.
Welche Stimulanzien Betschwestern aus den Beitrittsgebieten, halbgaren Plappermäulchen oder dauerspektakelnden Schlabaken die Hemmschwelle nehmen, ihre profunden Lebenserkenntnisse und Kalenderweisheiten regelmäßig in der Regenbogenpresse auszubreiten, wissen wir nicht – und wollen es auch gar nicht wissen. Zumindest das soll einmal Geheimnis dieser mitteilsamen Medienprofis bleiben. Wäre als Abrundung eines einigermaßen unflätigen kleinen Exkurses in die Chronik der neueren programmatischen Humanitas nicht vielmehr eine Analogie aus der Historie angebracht? Ita sit.
Der römische Kaiser Gaius Caesar Augustus Germanicus, der heute unter dem Namen Caligula bekannter ist, verkündete im Jahr 41, seinen Intimus Incitatus im darauffolgenden Jahr zum Konsul ernennen zu wollen. Dazu kam es freilich nie, weil die Prätorianergarde ihren Cäsaren aus vielerlei Gründen vorher abmurkste. Was, magst du fragen, könnte so erzählenswert daran sein, wenn ein Bestimmer seinen besten Kumpel und treuen Parteigänger mit einem Senatssitz bedenkt? Zumal doch von einer solchen Protektion – oder Altersvorsorge – das große Ganze vermutlich kaum berührt worden wäre. Gleichwohl liegt der vorliegende Fall ein kleines bisschen anders.
Der brave Incitatus war nämlich nichts weniger als verdientes Rennpferd aus dem Rennstall der grünen Zirkuspartei [sic!]. Die Anekdote erzählt freilich nicht einfach vom Wahnsinn eines Despoten. Sie ist vielmehr beispielgebend für jene unselige Mischung aus Protektionismus und Peter-Prinzip – die essenziell auf die fachliche Kompetenz qualifizierterer Zuarbeiter bauen muss und sich erlaubt, auch noch den jämmerlichsten Zossen aus dem eigenen Stall freizuhalten. So sichert schon ein episodisches Unterkommen im Stall der großen Politik dem unverständigsten Ackertreter ein auskömmliches Gnadenbrot. Selbstredend zu Lasten der arbeitenden Bevölkerung. Dieses Sponsoring findet sich in allen Epochen und Systemen gleichermaßen. Die wesentlichen Unterschiede zu Caligulas Lieblingskumpel werden sich darauf beschränken, dass des Cäsaren Gaul wenigstens irgendwann mal was konnte.
****
Hast du dich eigentlich nie gefragt, weshalb gerade beinharte Moralapostel Unarten, welche man sich und Seinesgleichen niemals zugestehen würde, bei Zuzöglingen ganz gern gönnerhaft weglächeln? Oder auf dem Wühltisch der immerwährenden Indulgenz willfährig nach psychosozialen Umständen grabbeln, wenn’s Lächeln tatsächlich völlig unangebracht ist?
Mit Glatzen und Springerstiefeln wird Fremdenhass assoziiert. Das ist weitgehend gesellschaftlicher Konsens und soweit regelmäßig auch zutreffend, solange wir nicht von Punkern sprechen. Was ist mit solcher Kritik an jungen Männern, die sich beispielsweise unter einem French Crop und in Airmax cooler finden? Wie lange lässt sich die Diskrepanz von Anspruch und eigenem Potential ertragen, wenn du jung, stolz und dumm wie Bohnenstroh, aber knackevoll mit hochfahrenden Illusionen bist? Wie viele Abfuhren verträgt ein mühsam gepimptes Ego, bevor Frust und Neid auf Erfolgreichere in Wut umschlagen? Ist Rassismus unter Braids und in knallroten Hi-Sneakern überhaupt wahrscheinlich? Wo doch schon die Kombi so knuffig daherkommt. Beinahe wie ein plüschiges Pummeleinhorn.
Wird Gewalt etwas weniger gewalttätig, wenn Täter selbst Opfer gewesen sind? Macht eine Traumatisierung durch Flucht, Folter oder Vertreibung Gewaltaffinität folglich verständlicher – gar entschuldbarer – als jene, die ihre Ursache beispielsweise in einer missbrauchten Kindheit hat? Womöglich sollte man seine ideologisierte Perspektive von Zeit zu Zeit mal selbstkritisch unter die Lupe nehmen.
Haftet dem immer wieder rausgekehrten Zusammenhang zwischen einer kurzen Lunte und soziokulturellen Prägungen nicht zwangsläufig das Geschmäckle einer generösen Herrenmoral an? Und wer geneigt ist, einem verbiesterten Misogyn, Juden- oder Schwulenhasser dessen krude Weltsicht aufgrund Herkunft, Abstammung, oder kulturellem Hintergrund eher nachzusehen, als einem Glatzen-Peter oder Stammtisch-Franz ist kein bisschen weniger engstirnig als diese. Ideologische Provinzialität wird immer daran glauben, dass just die eigene Vorstellung von Wertigkeit oder „Normalität“ von universeller Relevanz sei.
Für die Leidtragenden und ihre Familien macht es nun mal keinerlei Unterschied, ob ein paar gelangweilte Honks in Cottbus einen dunkelhäutigen Ingenieur auf seinem Nachhauseweg totprügeln – oder in Detroit eine hellhäutige Lehrerin über den Haufen geschossen wird, weil der Motor ihres klapprigen Kleinwagens unbedingt mitten in einem Black Supremacy Revier schlappmachen musste. Ob ein Dienstherr in den Emiraten die philippinische Kinderfrau straflos abstechen darf, weil sie in den Augen arabischer Herrenmenschen weniger zählt als sein Jagdfalke. Sie ist in einem fremden Kosmos nicht weniger schutzlos als die Waldmenschen Amazoniens, die in ihren eigenen Rückzugsgebieten von Nachfahren der einstigen Sklaven und Kolonisten praktisch nach Belieben abgeschlachtet werden. Für Gartenmöbel aus Tropenholz. Für unsere Essgewohnheiten. Weil es manche geil macht, nackte Angst in arglosen Gesichtern zu sehen.
So unterschiedlich Herkunft und Lebensumstände der beschriebenen Menschen sein mögen, so haben sie doch alle eins gemeinsam. Man nimmt ihnen ihr Leben keineswegs, weil man sie persönlich hasst. Ihre Persönlichkeit wird ja gar nicht gesehen. Sie werden plattgemacht, weil sie ein Vorurteil repräsentieren und/oder halt einem fragwürdigen Fortschritt im Weg sind. Weil sich die Stinkwut über die eigene Ohnmacht bevorzugt noch Schwächere als Ventil sucht. Weil Selbstüberhebung seit jeher glauben will, Menschsein mit wenigen Eckpunkten skizzieren zu können. Und weil die Ignoranz vieler der Arroganz einiger weniger immer wieder viel zu kleinlaut zugesteht, vorgeblich Wertvolleres und vermeintlich Minderwertiges lauthals zu klassifizieren.
Noch immer halten die Angehörigen aller vier indischen Kasten die Dalits klein, die sie selbst als „Unberührbare“ bezeichnen. Im modernen China wird Minderheiten wie Tibetern oder Uiguren die Lebensweise der Han aufgezwungen. Laut Menschenrechtsorganisationen werden seit Jahren Hunderttausende in Arbeitslagern ausgebeutet und ihrer Menschenwürde beraubt, um etwaige separatistische Bestrebungen in Grenzregionen im Keim zu ersticken. Massenvergewaltigungen, Zwangssterilisationen und subtilere Foltermethoden sind erprobte Elementarstrategien zur Durchsetzung dieser Ziele.
In Europa sind augenscheinliche Zuwanderer häufig bis in die x-te Generation automatisch verdächtig und so ziemlich auf jeder gesellschaftlichen Ebene benachteiligt. Auch der Antisemitismus marschiert wieder ungeniert, findet Beifall nicht mehr nur in wissend nickendem Einverständnis.
Im postkommunistischen Russland werden immer häufiger Minderheiten Ziel offener rassistischer Anfeindungen. Bitterste Armut und schamloser Reichtum sind nicht etwa einer Kleptokratenclique unter Führerschaft eines Ex-KGB anzulasten – sondern dem „internationalen Finanzjudentum“, wenn man dem einträchtigen Geschwafel russischer Kommunisten bis Nationalisten folgen mag. Und wo der Mensch Abend für Abend hungrig zu Bett geht, ist sein Gemüt besonders empfänglich für Massenideologien. Putin weiß sich als Identifikationsfigur bei seinen Leuten in Szene zu setzen und vaterländische Emotionen wie imperiale Sentiments zu bedienen. Ob auf Promo-Tour mit seinen „Nachtwölfen“ auf einer (vorsichtshalber) dreirädrigen Harley, als Eishockeycrack, Schwarzgürtel oder unerschrockener Löschflieger – stets sind zufällige Kameras in der Nähe, die die halbgaren Husarenstücke des russischen Hansdampfs feiern.
Auch die Taiga muss als Kulisse für alberne Kraftmeierei herhalten. Der wilde Wladimir als tapferer Bärenjäger. Halbnackig auf Zwergpferdchen „Goliath“. Als fischefangender Naturbursche an rauschenden Wassern. Ich persönlich finde schon die Sujets eher zum fremdschämen. Aber klar kann man auch einem Zwockel hinterherlaufen der, genau hingesehen, das Charisma einer angefressenen Leberwurstsemmel mitbringt und ohne Fußbänkchen kaum über die Tischkante kucken kann. Für mich stellt sich da die Frage: Was sagt das über Millionen glühender Verehrer aus? Wir dürfen doch davon ausgehen, dass des Potentaten präpotente Posen keineswegs nur bei den ganz Schlichten verfangen. Es macht verdammt wenig Sinn, bei jeder Gelegenheit den Muschik zu geben, wenn sich das eigene Volk darüber schieflacht. Denn was sollten Machtmenschen mehr fürchten, als die eigene Lächerlichkeit – und ihren Bedeutungsverlust?
Für die eigenen Legende mag selbst im Stande fortgeschrittener Senilität noch Zeit sein. Bekanntlich reiten Eroberer seit Jahrhunderten nicht mehr selbst übers Blachfeld. Sie lassen siegen, um ihr Vermächtnis in Bronze zu gießen, die eigene Eminenz in Stein zu meißeln. Verschlafen die, von ihnen angerichtete, Barbarei in aufgeschüttelten Daunen, schlafen den seligen Schlaf der Gerechten in den weichen Armen fürsorglicher Frauen. Würden auch für den eigenen Ruhm keinen Augenblick riskieren, erschöpft und todmüde im knietiefen Wasser von Schützengräben zu hungern oder auf dem Feld der Ehre zu verfaulen. Wozu haben sie schließlich gelernt, zu manipulieren?
In einem Alter, in dem man sich mit Themen wie Zukunft, Liebe und Nestbau oder damit auseinandersetzt, wo man nach Feierabend seine Kumpels trifft, werden Milchbärte für wirtschaftliche Interessen und die Launen alter Säcke verheizt. Müssen für deren Angst vor dem Vergessenwerden Gleichaltrige metzeln und sich selbst verkrüppeln- oder totschießen lassen. Indessen gehört nicht besonders viel Heroismus dazu, den Finger zu krümmen.
Wirkliches Heldentum ist überhaupt nur den wenigsten bestimmt. All diese Verführten oder Abenteuerlustigen bleiben sehr viel häufiger auf irgendeine Weise auf der Strecke. Weil sie noch zu selbstgewiss sind, um richtig zuzuhören. Zu stolz, um womöglich rechtzeitig wegzulaufen. Und einfältig genug, ihre Kaltschnäuzigkeit in die Waagschale zu werfen und das mit Tapferkeit zu verwechseln. Nur, was wiegen tausend läppische Tapferkeitsorden gegen ein einziges nicht gelebtes Leben? Euphemismen wie „Ehrenfriedhöfe“ könnten Abermillionen trostloser Geschichten vom ultimativen Opfergang erzählen. Kann man sein blühendes Leben eigentlich noch billiger abschenken, als für die Unsterblichkeitsfantasien wirkmächtiger Greise und beschissene Abstraktionen?
In einem Angriffskrieg geht es um menschliche Gier und Sucht. Um Machtgier und Raffgier, um Bewunderung und historische Unsterblichkeit. Bei der Abwehr eines solchen eher selten um die Verteidigung einer „Schicksalsgemeinschaft“, „des Vaterlands“, der „Freiheit“ oder „Heimat“. Bewährtes also, dem man auch gerne das noch unbescheidenere Attribut „heilig“ voransetzt, um die Legitimation von Gewalt über ethische Zweifel zu erheben.
Nimm deinen Untertanen ihre Zuversichten, zertritt ihr bisschen menschliche Würde. Opfere Ihre Töchter und Söhne für deinen Größenwahn – nutze ihre gebündelten Ressourcen für deine Rendite. Sie werden gleichwohl ängstlich unter deine Fittiche kriechen, wenn du sie glauben machsen kannst, führungslos verloren zu sein. Schenke ihnen eine schmierige kleine Ideologie, teile deine Götzen und benenne ihre Feindbilder. Dein Volk wird dich nicht nur fürchten, sondern ergeben bis in den Abgrund hinterherlaufen.
Das Elsass ist in seiner Geschichte mindestens vier Mal hin und her gegangen. Viele Menschen blieben nach jeder Abrechnung der Einfachheit halber wo sie waren, wenn man ihnen die Wahl ließ. Sie nahmen den französischen Frieden so ergeben hin, wie sie den deutschen Krieg hinzunehmen hatten. Aktuell geben Straßburger eben den patriotischen Franzosen, vive la France, vive la paix, vive toute cette merde. Auch nicht eben sinnstiftender als: „Ich bin stolz, Deutscher zu sein“.
Zeugt die Verklärung verhängnisträchtiger Zugehörigkeit nicht von Individualitätsproblemen? Von Lebensangst, Vereinsamung, Angewiesensein? Ist gleichsam Beleg für Ressentiments gegen Menschen anderer Kulturen? Sicher nicht zwingend, aber mindestens zeigen atavistische Reflexe, die Lust an methanschwangerer Tümelei und der wiederbelebte weltweite Krebsgang in Richtung Nationalstaaten, wie schnell sich institutioneller Identitätsschwulst und die beabsichtigt geschürte Aversion gegen das unterstellte Anderssein verselbständigen kann, wenn der Kessel ungeplant unter Druck gerät.
Zweifellos hat der Patriotismus seine Schublade noch unter den Religionen. Diese Überlegenheits- und Hurrabrühe wird auch in Friedenszeiten auf kleiner Flamme und unter sporadischer Zugabe verbindender Zuckerchen am Simmern gehalten. „WIR sind Papst“. Das hat seinerzeit selbst manch teutonischen Agnostiker heiter gestimmt. So werden auch nicht nur elf Kicker Freunde Jungmillionäre Weltmeister, sondern ein stolzes Volk – nicht ganz zufällig wieder einmal WIR. Andererseits eine ganze Nation mitleidet, wenn „Poldi“ oder „Schweini“ entscheidende Elfer versemmeln. Vereint im Triumph wie in gemeinsamer Bedrängnis.
Ich will gar nicht abstreiten, dass es nicht von Schaden sein kann, aufmerksam und wehrhaft zu bleiben. Schließlich wird selbst die friedfertigste Einstellung nicht immer verhindern, dass der Psychopath von nebenan zur Lösung seiner gescheiterten Innenpolitik auf rohe Gewalt nach außen setzt. Wenn zum Hochamt für Sadisten und Soziopathen geläutet wird und es für Spekulanten läuft wie geschmiert. Alle anderen zahlen garantiert drauf - selbst die feiernden Fahnenschwenker. Kriege machen aus zivilisierten Menschen regelmäßig Barbaren – und aus fröhlichen traumatisierte Zombies.
Wenn die Messe gelesen ist, darfst du deinen Nachbarn natürlich nicht mehr totschlagen. Dir die Nachbarin gewaltsam vornehmen. Oder ihr kleines Häuschen anzünden. Das wäre total unethisch. Sind doch auch erklärte Feinde menschliche Wesen. Doch, irgendwie schon. Der, vordem so völkische, Volksgenosse sitzt nun ernüchtert auf den Trümmern seiner Existenz, während die Scharfmacher meist noch immer in der eigenen Soße schwimmen. Bekömmlichen Tee miteinander trinken. Das gute Porzellan hat keinen Schaden genommen. Man lächelt sein fettiges Politiker- oder Bonzenlächeln, patschelt sich leutselig die weichlichen Präsidenten- und Bankiersschultern. Beschwichtigt einander wortreich. Manchmal hat sich schon der nächste Schweinehund die Pfründe des Versagers gekrallt, aber das ändert nichts. Bleibt unfehlbar beim gleichen Typus. Die Sorte ist dem Teufel nie ausgegangen.
****
Die sukzessive Erlangung der Unabhängigkeit afrikanischer Staaten bedeutete keineswegs das Ende der Ausplünderung dieses Erdteils und seiner Bevölkerung. Lokale Eliten übernahmen die kolonialen Strukturen. Diese Clans reichen die Macht konsequent innerhalb ihrer Strukturen weiter und bedienen die unersättlichen Weltmärkte zur persönlichen Bereicherung oder zur Finanzierung lokaler Konflikte. Ihre feudalistische Legitimation beziehen sie aus der vorgeblichen Wertigkeit von Angehörigen unterschiedlicher Volksgruppen.
Warum sollte schwarze Anmaßung auch weniger menschenverachtend daherkommen, als weiße oder gelbe? Gesundheitswesen und Infrastruktur im rohstoffreichen Kongo sind gut sechzig Jahre nach Abzug der belgischen Kolonialherren noch immer jenseits jeglicher Menschenwürde. Darüber hinaus geben Stichworte wie Kleinbergbau, Coltan und Kobalt einiges her.
Zum grassierenden umweltorientierten Dünkel hierzulande gehört zweifellos auch jene Wahrheit, dass afrikanische Kinder – gern in Regenwaldgebieten – systematisch ausgebeutet und kaputtgemacht werden, damit hiesige Blagen in Mamis elektrischem Zweieinhalbtonner zu Schule und Sport karriolt werden können. Hauptsache, den politisch korrekten Lifestyle für die eigene Show gekapert. Mit steigender Nachfrage nach verschiedenartigsten Elektronikgeräten wächst der Bedarf an selteneren Rohstoffen in „entwickelten“ Ländern weiter.
Da angesichts Profitmaximierung und oft primitivster Abbaumethoden weder an Sicherheits- noch Umweltstandards zu denken ist, sind Kinderarbeiter und ihre Familien in den Abbaugebieten häufig gezwungen, das kontaminierte Grundwasser zu trinken. Nicht zuletzt, weil europäische, US-amerikanische und chinesische Lebensmittelkonzerne weltweit Wasserrechte aufkaufen. Um das, in tiefer lagernden Schichten, reine Wasser, das seit jeher Gemeingut war, hochprofitabel in Einwegplastik abzufüllen und an Besserverdienende zu verkaufen.
Die geleerten Flaschen landen regelmäßig auf wilden Müllkippen. Genauso übrigens, wie Elektroschrott aus Überflussgesellschaften, der meist in Westafrika entsorgt und – wieder von Kindern – verwertet wird. Dass du für die fachgerechte Entsorgung deines Altgeräts bezahlst, garantiert noch lange nicht, dass es auch fachgerecht entsorgt wird. Das kostet nach EU Standards nämlich richtig Geld.
In Asien billig und umweltschädlich produzierte Fast-Fashion findet ihren letzten Weg oft schon nach wenigen Monaten bis in die Atacama. Was wir an billig und massenhaft produzierten „Lebensmitteln“ in subsaharische Länder ausführen, zerstört nicht selten die Lebensgrundlage örtlicher Kleinbauern. Spätestens an dieser Stelle könnte sich auch der dickfelligste Fondsanleger, sollte sich der unbedarfteste Konsument von 3 Euro Shirts oder 49 Cent Schokolade mal fragen, was die persönliche Nutznießung an diesen Ausbeutungsketten anderes sein soll, als Rassismus.
Australiens Aborigines erklärte man zu Tieren, um Völkermord und Landraub vor Gott und dem eigenen Gewissen zu rechtfertigen. Rechtlosen Eltern wurden ihre Kinder bis in die 1970er einfach weggenommen, um sie fürsorglich ihrer eigenen Kultur zu entfremden und in eine weiße, also „gottgefällige“, Gesellschaft zu assimilieren – und Ethnie wie Identität womöglich über wenige Generationen „wegzukreuzen“. In vorderster Linie, der Begriff „Fürsorge“ drängt diesen Verdacht förmlich auf, machten sich auch um diesen Ethnozid insbesondere christliche Missionen verdient. Das „Blackbirding“, die zwangsweise Arbeitsverpflichtung von Mikronesiern und Melanesiern, war nichts anderes als Menschenhandel bis weit ins 20. Jahrhundert.
In den Vereinigten Staaten lief es kein bisschen anders. Die Weißhäute gaben nicht eher Ruhe, bis sie sich mit roher Gewalt unter den Nagel gerissen hatten, was Lebensgrundlage derer bildete, die Political Correctness heute nicht mehr mal Indianer nennen darf. Auch wenn sich die meisten Rothäute als Überbegriff ihrer Stammesnation selbst so bezeichnen – und politische Organisationen, wie „American Indian Movement“ oder „National Congress of American Indians“, die sich für die Rechte ihrer eigenen Ethnie einsetzen, das (gar nicht so) strittige „Indian“ gar in ihrer Selbstbezeichnung führen.
Aber was wissen Naturmenschen und gewohnheitsmäßige Trunkenbolde schon von zivilisatorischen Feinheiten? Ganz offensichtlich sind auch die Nachfahren amerikanischer Ureinwohner überfordert und müssen von einer vornehmlich weißen Sprachpolizei dringlich in der Einordnung ihrer eigenen Identität unterwiesen werden. Wenn die noch nicht mal ihre korrekte Selbstbezeichnung alleine hinkriegen. Die meisten Rassisten merken wahrscheinlich nicht mal, wie rassistisch sie unterwegs sind.
In beinahe allen Gesellschaften aber müssen noch immer die Frauen als „Sklaven der Sklaven“ herhalten. Sie sind die wirklichen „Nigger of the world“, wie John Lennon einst so treffend vortrug. Das patriarchale Machtprinzip breitete sich im Zeitalter der Entdeckungen und Eroberungen wie andere Zivilisationskrankheiten über die ganze Welt aus. Bevor Conquistadoren im 16. Jahrhundert die Philippinen für die spanische Krone eroberten, wurden Mädchen dort ebenso frei und selbstständig erzogen wie Jungs. Auf dem gesamten Archipel gab es so gut wie keine sexualisierte Gewalt. Die jungen Frauen verfügten nicht nur nach Gutdünken über die eigene Jungfräulichkeit, sondern ganz selbstverständlich über ihre gesamte Lebensgestaltung. Spanische Missionare trugen im Namen Christi nachhaltig Sorge, dass aus unzivilisierten Wilden Kinder Gottes werden durften. Seit seiner Erleuchtung verehrt auch der Filipino die Madonna und vögelt oder vermöbelt seine Filipina, wenn IHM danach ist. Wie praktisch für passionierte Frauenprügler, dass die heilige Mutter Kirche zudem dafür Sorge trägt, dass Scheidungen bis heute gesetzlich verboten sind.
****
Zeit, zum Wanderzirkus der Wunderkinder zurückzufinden. Zu besagten „bildungsinteressierten Eltern“ habe ich spätestens seit meinen Berliner Jahren ein eher ambivalentes Verhältnis. Die meisten sind eigentlich ganz reizend, solange man sich thematisch auf Musik, gutes Essen und das Wetter beschränkt. An fundamentale Selbstzweifel verschwenden viele dieser Menschen erfahrungsgemäß eher wenig Energie. Maß aller Moralität kann ausschließlich die eigene geozentrische Weltsicht sein.
Da wird dann konsequent verteidigt, wozu das eigene Dasein gar keinen inneren Bezug hat. Subventioniert, wo es nicht wirklich was kostet. Leidenschaftlich debattiert, wenn es um den Sack Reis in China geht und sich engagiert, wo es in erster Linie gilt, das eigene Gewissen zu beschwichtigen. Die multikulturelle Kiezschule ist für den eigenen Ableger selbstredend auch nur deshalb ungeeignet, weil dem hochsensiblen kleinen Intelligenzbolzen eine, möglichst schwammig definierte, Außenseiterrolle erspart bleiben muss. Womit die Eltern ihrem Kind, bei Licht besehen, womöglich einen Gefallen tun. Wohl dem, der sich’s leisten kann die Mittel hat.
So können auch Leonce und Luna ohne Irritationen zu konzilianten Kosmopoliten heranwachsen – geradeso, wie man sich selbst einschätzt. Das Dasein ist zwischen Nachhilfe, KinderYoga und Violinunterricht ohnedies hart genug. Kritische Fragen bügelt Freund Feingeist geflissentlich mit erprobten Killerphrasen ab. Konsultiert Mami nicht einen persischen Frauenarzt? Bringt Papi sein fragiles Gleichgewicht nicht für richtig Geld beim original tibetanischen Zen-Advisor ins Lot?
Pflegt man nicht überhaupt ’ne Menge Bekanntschaft aus jeder Weltgegend? Sponsert sogar einen geheimnisumwitterten graubärtigen Kubaner, von dem geraunt wird, dass er einst mit Che Guevara leibhaftig durch die bolivianischen Bergwälder gekrochen sein soll. Der die immer gleichen Anekdötchen in Touristenkneipen anderer Bezirke allerdings auch ohne viel Geraune gegen das eine oder andere Viertele eintauscht. Wer will dem alten Mann einen Vorwurf machen? Er hält nur seine Erinnerungen in Ehren. Viele wären gern gewesen, was sie nie sein konnten. Hingegen muss die eigene Putzfrau bei der selbstgefälligen Leistungsschau regelmäßig außen vor bleiben, weil nicht sozialversichert – zum beiderseitigen Besten natürlich. Erst vor wenigen Monaten ersetzte ein Neuzugang aus Bulgarien die Türkin, die zu gierig wurde.
Versetzen wir uns zum Schluss doch mal in ein imaginäres soziales Experiment. Platzieren ein paar Wohncontainer mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten auf dem Gethsemaneplatz. Aus dem eine gutmeinende Initiative ohnehin einen Ort der Begegnung machen möchte. Immerhin beweist man mit seinem Anliegen einmal mehr Sinn für kraftvolle Symbolik. Kam es doch bekanntlich schon im namensstiftenden Garten zu mehr oder minder nachhaltigen Begegnungen: „Judas, Dein Mundwasser ist zu schwach“, oder „Malchus guck mal, ich hab Deinen rechten Lauscher unter ’nem Ölbaum aufgelesen“.
Warum also nicht gleich eine Begegnungsstätte der interkulturellen Interaktion? Ein völkerverbindender Ringelpiez mit Anfassen sozusagen. Wohnboxen ins Nervenzentrum jenes sorglich strukturierten Savoir-vivre. Mitten in eine kollektive Humanitätsduselei, die sich hier so dünkelhaft wie kaum sonst in der Republik im eigenen Schaufenster ausstellt – und entsprechend chronisch missinterpretiert.
Merkste wat, Keule? Auch für den Menschenfreund der Jetztzeit ist’s noch immer am bequemsten, von oben herab in die abgewetzten Hosen derer zu scheißen, in die Sattbürgerlichkeit seit jeher vorzüglich zu scheißen pflegt.