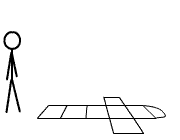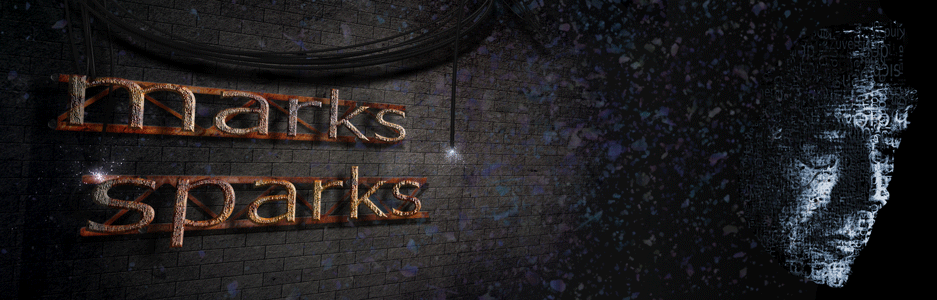Von der Kunst, demütig zu bleiben
Mila erzählt von einem Traumtänzer, der sich auf den Weg durch halb Europa macht, um ein trauriges Gesicht aus einem Magazin zu finden – und vielleicht auf ein paar unverhoffte Antworten auf abgenutzte Fragen zu stoßen. Der Protagonist ist, wie die meisten Menschen, außerstande, überkommene Verhaltensmuster auch nur infrage zu stellen. Ich selbst war an diesem Punkt, wo einem die eigene Biographie nichts als ein schlechter Witz scheint – und jede erdenkliche Zukunft Drohkulisse. Mochte damals auf eine mitfühlende Seele gehofft haben, die mich aus dem Dreck auflese und auf ein zielführendes Gleis setze. Oder sich womöglich eine noch verlorenere fände, weil das Gebrauchtwerden bekanntlich davon abhält, unentwegt in eigenen Existenzängsten zu mantschen. Aus solch elementarer Not entstand eine so trübe, wie emotional distanzlose, Fantasie, deren Niederschrift immerhin mir stundenweise Ablenkung und Entlastung verschaffte. Das fertige Manuskript vermochte indes meine eigenen Ansprüche an Sprache und Thematik kaum zufriedenzustellen. Damit hätte ich die ganze Geschichte ganz gut auf sich beruhen lassen können.
Sobald allerdings seelische Kernschmelze, Traumabewältigung oder sehr persönliche Reminiszenzen obendrein zur Ambition geraten – wenn also als Botschaft in die Welt posaunt werden soll, was lediglich als emotionale Rekonvaleszenz angedacht war, ruckt die Mühle erst richtig an. Realitätsverlust gibt sich ja nicht damit zufrieden, kurz vorbeizuschauen, er richtet sich erfahrungsgemäß häuslich ein. Frisst sich fett und passt sich den Anforderungen an. Und machte sich nunmehr daran, den Blick auf das eigene Elaborat gründlich zu verändern. Was glaubst aber ausgerechnet du, der Welt erzählen zu müssen, von dem sie noch nichts weiß? Naturgemäß schielt Exposition nach Anerkennung, nach Bestätigung – nach Tantiemen womöglich – und läuft dabei Gefahr, die originäre Absicht komplett aus den Augen zu verlieren. Und selbstverständlich beweisen selbst publizierte Manifestationen die sorgsam gepäppelten Lebenslügen keinesfalls als verbindliche Wahrheit.
Was ließe sich zu meiner Entlastung vorbringen? Wo ich zweifelte, ermunterten mich andere. Nota bene – und ich wurde ziemlich kräftig angeschoben. Aber auch das muss Halbwahrheit bleiben. Geböte ein gesundes Ego nicht, selbst heftigstem Zuspruch mit allfälliger Skepsis zu begegnen – und wenn wohlmeinende Einflüsterungen der vermaledeiten Eitelkeit noch so zusetzten? Daraus erschließt sich, dass es ebenfalls kaum hilfreich sein kann, die Ursachen für eigene Lebenshavarien unbeirrbar in wohlfeilen Ratschlägen, einem Zuviel an Leutseligkeit oder der Bosheit Anderer – in denkbar schlechten Grundvoraussetzungen also – zu suchen.
Jedenfalls entwickelte diese Geschichte irgendwann ihre eigene sture Dynamik. Wurde von einer Abstraktion zu Materie – durfte Buch unter Büchern sein. Gleichwohl blieb sie stets mein Kind. Bis heute schwanke ich darüber zwischen Stolz und Verlegenheit. Indessen möchte ich selbst aus dem inneren wie zeitlichen Abstand noch immer trotzig behaupten, dass geschätzte neunzig Prozent aller aktuellen Romanveröffentlichungen Lesers Lebenszeit noch sinnfreier verplempern.
Der Roman entstand etwa zu gleichen Teilen in meiner Wohnküche in der Jadwigi und einem heimeligen Café nahe des Plac Nowy. Im Mleczarnia war ich bald gern gesehener Gast, weil ich durchaus unterhaltsam und liebenswert sein kann. Ersaß mir hartnäckig Stammplatz und Alltäglichkeit und formulierte die Schrullen und Grillen in meinem Kopf so gewissenhaft wie unstrukturiert in Schulhefte der Warschauer Marke: „Top-2000“. Maritime Collection, fernwehfördernde Großsegler auf dem Umschlag. Grundsolide Qualität, wenngleich der Firmenname für meinen Geschmack zu wenig gegoren scheint. Top-2000. Drängen sich da nicht eher Bilder runtergeranzter Spielhallen auf, als reinweiße Schreibhefte? Ein chemisch müffelnder Matratzenabverkauf, der sich mirakulös ins dritte Jahrtausend gebeamt hat, oder einer jener Traditionsdöner, welche auch Geflügelcurrywurst, Pizza und pfandfreie Dosenlimonade im Sortiment führen? Grundsätzlich ist Top-2000 ein Klassiker der Kategorie: fantasielos hingeluderte Warenzeichen mit garantiertem Verfallsdatum.
Aber ich verliere den Faden. Einmal mehr. Seriöses Schreiben kann mitunter, auch wenn es selten danach aussieht, in Arbeit ausarten. Sujets, Semantik oder zielgenaue Satzwendungen fliegen einem ja nicht bereitwillig zu, weil man ihrer gerade bedürftig ist. Wenigstens nicht mir. Indes entfremdet man sich in einem Zuviel an Gedankenbildern allzuleicht der eigenen Realität. Du bist gezwungen, immer wieder aufzutauchen, um nicht gänzlich im Romanhaften abzusaufen. Zwischen zwei zu feierlichen Zeilen, pappsüßen Sentimentalitäten oder den paar Imperativen, die dir Erfahrungen und Lebensangst diktieren.
Die Absicht einer Botschaft gebietet nicht nur ein Gespür für relevante Themen, Logik und ein selbstverständliches Sprachverständnis, sondern – vor allem – Empathie mit der Begriffsstutzigkeit zügellosen Interpretationslust verschiedenartigster Leser. Überhaupt fordert der Gedankenaustausch zwischen zwei Menschen Sprache nicht annähernd dieselbe Eindeutigkeit ab, wie das niedergeschriebene Statement. Sind doch bereits stimmlicher Ausdruck und Mimik häufig sehr viel aussagekräftiger als die Worte selbst. Eine gleichgültige Miene wird jedes Kompliment als Plattitüde beschämen, während schon eine ungelenk formulierte Belanglosigkeit in einem persönlichen Brief schnell zum unbeabsichtigten Torpedo werden kann. Ein depressiver Adressat neigt nun mal dazu, sein persönliches Waterloo bereits aus einer einzigen missverstandenen Satzwendung abzuleiten. Hingegen dem unbeirrbaren Positivisten selbst aus den garstigsten Beleidigungen Morgenluft entgegenströmen mag. Hat sich da nicht etwa ein Mitmensch die Mühe gemacht, MICH zu beschimpfen? Ein Dialog bietet die Möglichkeit, nachzufragen, sich zu vergewissern, zu klären. Zu überdenken, oder mindestens zum Überdenken anzuregen.
Gerade der Plausch ist ausgesprochen angetan, Stresslevel und Gedankenmühle runterzufahren. Jene Kunst einer munter mäandernden Konversation, die sich’s gern zwischen Karottenkuchen und Schokoladenkännchen gemütlich macht. Reizthemen anderer Stammgäste zu geläufig, um anecken zu müssen. Vertrautheit hilft, Untiefen zu umschiffen – gerade, wenn dir die Motivation für argumentatives Tauziehen abgeht. Und zufällige Diskutanten mit einer gesunden Sozialisation kommen sich emotional ohnehin selten so nah, dass selbst manifestere Meinungsdifferenzen kaum eskalieren sollten. Was soll es bringen, einen Wildfremden vom Weltfrieden zu überzeugen? Rechthaberei ist was für instabile Kantonisten und Agitation sollte man durchhaben, bevor man erwachsen wird. Ganz anders kann es laufen, wenn du in einem verqualmten Vorstadtbums extreme Überzeugungen allzu vorlaut in Frage stellst. Wo dich bereits ein fehlgedeutetes Grinsen mirnichtsdirnichts vom Saufkumpan zum Watschenmann machen kann.
Das Mleczarnia duldete keinen Krawall. Animositäten, Ängste und Vorurteile wurden anstandslos gelitten und durften bleiben, was sie sind – lässliche menschliche Schwächen. In der respektvollen Distanz der Stammgäste zueinander war gar nicht angelegt, besserwisserisch aufzutrumpfen, so wie es jedermann leicht gemacht wurde, selbst gutmeinende Einreden bei Nichtgefallen zwanglos zu überhören. Es schien, als verpflichte man sich allein mit Betreten dieser Räumlichkeiten zu einer verbindlichen, gleichsam blutleeren, Brüderlichkeit. Mindestens zu temporärer Toleranz. Brummte der Laden nicht gerade, wurden meist Neuigkeiten von ehegestern abgeweidet. Selten sinnstiftend, manchmal ermüdend und häufig über zwei Tische weg. Aber niemals unversöhnlich. Was wäre denn die Alternative gewesen? Klar kannst du dir den halben Tag Koffeinbrühe und Cognacs in den Hals schütten, abwesend vor dich hinmurmeln oder manisch ein Loch nach dem anderen in die Luft starren, während du in der kalten Asche nach Rosinen stocherst. Besonders, wenn du deinen Mitmenschen partout unheimlich werden willst.
Zwar wuchs Mila in diesem denkbar entspannten Umfeld stetig, aber keineswegs spielerisch heran. Fand ihren Weg zunächst in selbstnummerierte Hefte besagten Fabrikats. Durchgängig kariert und mit Doppelrand für etwaige Vermerke. Heiliges Nüsschen. Welch eine Orgie aus Sauklaue, Korrekturen, Fußnoten, Achtlosigkeitsflecken und Eselsohren. Der ganze Wust dem unbedingten Willen unterworfen, Plot und Gefühlsspektren in eine ansprechende Sprachmelodie zu fassen und zu guter Letzt womöglich auch noch auf eine schöngeistige Ebene zu bugsieren. Was hatte mir meine Trübsal da bloß ans Bein gebunden? Was willst du aber machen, wenn sich Anspruch und Fertigkeiten wenig zu sagen haben? Man sucht eben mit dem Werkzeug zurechtzukommen, das einem das Leben in die Hand gedrückt hat. Und stirbt nicht Hoffnung bekanntlich …?
Nun sind wahrhaftige Künstler recht dünn gesät und so muss, neben dem Erlesenen, zwangsläufig auch trivialeres zur Sättigung des Marktes an eine gewillte Leserschaft gebracht werden. Darauf kann die Gilde der solide handwerkenden Geschichtenerfinder bauen. Das verhilft auch Legionen von – mehr oder minder – verständigen Literaturkritikern, Werbemanagern und gewerbsmäßigen Lobhudlern zum Broterwerb. Da wird regelmäßig manch seitenfressende Suada zum rasanten Reißer hochgetrommelt. Gleichwohl sind bestsellernde Fließbänder kaum verzichtbar, weil sie einträglich imstande sind, gefällige Gefühlsstanzen oder Gänsehaut pausenlos und in eingängiger Systembaukastendiktion auszuwerfen. Viele Leser legen zudem Wert darauf, ausschließlich innerhalb der eigenen Vorstellungswelt bewegt zu werden und nicht jeder sieht einen Gewinn darin, beim Lesen mitdenken zu müssen. So kann es kaum verwundern, weshalb dem immerhin Lesewilligen, warum dem planlosen Geschenkesucher bereits beim Betreten eines Kettenbuchladens die immergleiche leichtverdauliche Sülze entgegenquillt. Und garantiert eine so beflissene, wie niedliche Verkäuferin mit einem Erzeugnis aus diesem hochgestapelten Gleichmaß um die Ecke kommt. So oder so konnte sich über die Jahre manch gutgemeinte Bestsellerscharteke zwischen Hintergründiges und Feinformuliertes schummeln. Das bedeutet mitnichten, dass sich jedes stirnrunzelnd angelesene Geschenk oder herzerwärmte Spontankauf in meinem Bücherregal auch festsitzen darf. Aber ein Buch respektlos wegschmeißen geht erst recht nicht. Gänzlich unerquickliche Schmöker entsorge ich seit geraumer Zeit unsentimental in öffentlichen Bücherschränken meiner Vorstadt. Gern verstohlen und im Schutz der Nacht.
Geschmack ist durchaus keine Geschmackssache. In den Nachkriegsjahrzehnten ließen sich nicht nur alte Kameraden von der sabbernden Landserromantik Heinz Günthers abschießen. Liebe, Triebe und Hiebe – das ganze Programm. Pfundweise deutsche Offiziersehre und lüsterne russische Lagerkommandantinnen mit windlos wehender Mähne und Nippeln wie Eisenbahnpuffer – solches Zeug. In den Wirtschaftswunderjahren gingen Klischees, die den tausendjährigen Teutonen entgegenkommend entlasten sollten, sowieso wie geschnitten Brot. Anzunehmen, dass der Verfasser und seine Schwiemeleien schon zwei Generationen später kaum noch ein Begriff sein werden, während das literarische Werk seines Zeitgenossen Italo Calvino zweifellos unsterblich bleiben wird.
Ihr Erfolg als Bestsellerautoren mag beiden – und auf denkbar unterschiedliche Weise – Recht gegeben haben. Konsalik war nach eigenem Bekunden stolz darauf, zeitlebens nicht einen einzigen Satz korrigiert zu haben. Wie hoch der Anspruch eines Schriftstellers an die eigene Kunstfertigkeit sein kann, soll das Lamento des Italieners verdeutlichen: „Wie gut ich schreiben würde, wenn ich nicht wäre!“ und weiter … „alles, was irgendwie dazu beiträgt, dass als mein erkennbar wird, was ich schreibe, kommt mir wie ein Käfig vor, der meine Möglichkeiten einengt.“ So jämert sichs im literarischen Olymp.
Von meinem Romänchen war jedenfalls schon vor der Redigatur weniger übrig geblieben als durchgestrichen. Unerfahrenheit verleitet, fehlende Leichtigkeit durch eine besonders gesuchte Ausdrucksweise wettzumachen. Unglücklicherweise gehen sperrige Schachtelsätze auch zu Lasten inhaltlicher Rasanz. So konnte das nicht wirklich gelingen, das weiß ich heute. Vielleicht hätte ein versierter Lektor geholfen. Mit einmal schien für nichts mehr Zeit. Weil auch noch das Weihnachtsgeschäft in den Fokus rückte. Wenn du einen verlässlichen Totengräber für dein solides Projekt suchst, engagiere die Hektik. Und schon die Basis dieses Buches gehörte definitiv nicht zu den solidesten. Aber am Ende war die Veröffentlichung auch immer meine eigene Entscheidung. Immerhin hat mich diese Erfahrung gelehrt, dass mir Essays, Anekdötchen oder Erzählungen gefälliger geraten. Weiters, beharrlich gegen meinen fatalen Hang zur Wortklauberei anzuarbeiten – zumindest dort, wo diese sprachlich dann doch zu sehr über die eigenen Füße zu stolpern droht. Ich schwöre, stets mein Bestes zu versuchen geben.